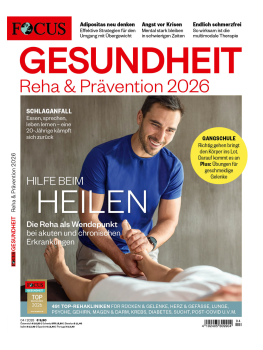© Shutterstock
Zusammenfassung:
- Definition: Eine seitliche Verkrümmung der Wirbelsäule und gleichzeitige Verdrehung der Wirbelkörper; kann die Hals-, Brust- oder Lendenwirbelsäule betreffen (HWS, BWS, LWS); kann schon bei Kindern vorkommen oder erst im Alter auftreten oder sich verschlimmern; Ursache bleibt meist unbekannt, nicht direkt vererbbar, aber Risiko steigt, wenn nahe Verwandte betroffen sind
- Symptome: z. B. Schmerzen, meist Rückenschmerzen; Verspannungen in der Schulterregion; optisch auffällig durch „Rippenbuckel“
- Welcher Arzt? Hausarzt, Kinder- und Jugendmediziner, Facharzt für Orthopädie
- Diagnose: oft schon auf den ersten Blick erkennbar, Bestimmung des Krümmungsgrades (Cobb-Winkel), Röntgen
- Behandlung: keine Behandlung bei leichter Skoliose, nur beobachten, sonst Physiotherapie zur Kräftigung der Muskulatur, (bei Kindern) Korsett zur Stabilisierung, in schweren Fällen Operation
- Sport: körperliche Aktivität ist ratsam, aber nicht alle Sportarten eignen sich (z. B. solche, die die Wirbelsäule belasten) – Sportart und Intensität mit Arzt besprechen
- Folgen: frühzeitig abgenutzte Wirbelkörper und Bandscheiben, Funktionsstörungen von Organen wie Lunge oder Herz
Der Name kommt aus dem Griechischen: „skolios“ bedeutet „krumm“. Entsprechend ist bei einer Skoliose die Wirbelsäule verkrümmt. Sie ist nicht nur leicht s-förmig geschwungen, sondern auch zur Seite gekrümmt. Gleichzeitig sind die Wirbelkörper verdreht.
Minimale Achsenabweichungen in der Wirbelsäule haben viele Menschen. Doch eine Skoliose liegt per Definition vor, wenn der Krümmungswinkel zur Seite mehr als zehn Grad beträgt. Die Verbiegung und zusätzliche Verdrehung der Wirbel betrifft meist den gesamten Rücken: Die Wirbelsäule verläuft bei einer Skoliose von der Halswirbelsäule (HWS) über die Brustwirbelsäule (BWS) bis hin zur Lendenwirbelsäule (LWS) nicht gerade.
Eine Skoliose besteht dauerhaft und ist eine chronische Wirbelsäulenerkrankung. Meist fällt sie schon im Kindesalter auf. Im Lauf des Lebens kann sich die Skoliose verschlimmern. Aufgrund der Verkrümmung kann die Beweglichkeit eingeschränkt sein. In schweren Fällen können Herz und Lunge wegen der verbogenen Wirbelsäule nicht richtig arbeiten, sodass Beschwerden wie Kurzatmigkeit auftreten können.

© Science Photo Library
Bei dieser schweren Form der Skoliose ist die Wirbelsäule über den gesamten Rücken zur rechten Seite verkrümmt
Cobb-Winkel
Der Schweregrad einer Skoliose lässt sich durch den sogenannten „Cobb-Winkel“ bestimmen. Er ist benannt nach John Robert Cobb, einem US-amerikanischen Arzt, der das Verfahren entwickelt hat. Folgende Gradeinteilung bestimmt bei einer Skoliose deren Schwere und entsprechend die Therapie:
- Cobb-Winkel <10 Grad: Es liegt keine Skoliose vor, entsprechend bedarf es auch keiner Therapie.
- Cobb-Winkel 10 bis 20 Grad: Es liegt eine leichte Skoliose vor, die aber keiner Behandlung bedarf.
- Cobb-Winkel 20 bis 25 Grad: Eine regelmäßig Physiotherapie ist ratsam, um die Krümmung mithilfe einer trainierten Muskulatur zu stabilisieren. Unbehandelt schreitet die Skoliose weiter fort.
- Cobb-Winkel 25 bis 50 Grad: Ab 30 Grad gilt die Skoliose als schwer. Junge Betroffene sollten ein Korsett tragen. Ansonsten gilt es, die Rückenmuskeln durch Kräftigungsübungen zu stärken.
- Cobb-Winkel >50 Grad: Die Skoliose muss chirurgisch korrigiert, also operiert werden.
Skoliose bei Kindern
Eine Skoliose kann schon bei Kindern auftreten. Mädchen sind ungefähr viermal so häufig betroffen wie Jungen. Vermutlich spielen hier hormonelle Veränderungen in der Pubertät eine Rolle. Meist handelt es sich um eine idiopathische Skoliose. Das heißt, sie entsteht ohne erkennbare Ursache während des Wachstums und macht ungefähr 85 Prozent aller Fälle aus. Seltener sind die Gene an der Wirbelsäulenerkrankung beteiligt.
Je nach Alter ordnen Ärztinnen und Ärzte die Erkrankung in verschiedene Kategorien ein:
- Infantile Skoliose: bis zum 3. Lebensjahr
- Juvenile Skoliose: 4. bis 10. Lebensjahr
- Adoleszente Skoliose: 11. bis 18. Lebensjahr
Selten entwickeln Neugeborene eine „Säuglingsskoliose“. Sie bildet sich meist von alleine wieder zurück.
Skoliose im Alter
Im Alter kommt eine Skoliose immer häufiger vor. Entwickelt sich die Verkrümmung aufgrund des natürlichen Alterungsprozesses in höherem Alter neu, sprechen Ärzte von einer De-novo-Skoliose oder einer degenerativen Skoliose. Bei Erwachsenen kann außerdem eine bestehende Skoliose im Alter schlimmer werden.
Skoliose: Ursache
Die Ursache einer Skoliose ist meistens unbekannt. Bei ungefähr 85 Prozent der Betroffenen gibt es keinen ersichtlichen Grund für die Verkrümmung der Wirbelsäule. Die Fehlstellung ist im Arztjargon „idiopathisch“.
Eine Skoliose ist nicht direkt vererbbar. Allerdings kann das Risiko für eine Skoliose erhöht sein, wenn enge Verwandte ebenfalls davon betroffen sind. Dies ist aus Zwillingsstudien bekannt. Wahrscheinlich sind aber noch andere Faktoren beteiligt. Dazu gehören zum Beispiel Bewegungsmangel, ein zu hohes Körpergewicht oder ungünstige Körperhaltungen im Alltag
Stellen Ärzte – in seltenen Fällen – doch eine klare Ursache fest, dann sind Nerven, Muskeln oder Knochen schuld an der Fehlstellung. Fachleute unterscheiden entsprechend drei Kategorien:
- Neuropathische Skoliose: Die Ursache für die fehlgewachsene Wirbelsäule ist eine gestörte Nervenversorgung im Bereich des Rückens.
- Myopathische Skoliose: Muskelschwund oder andere muskuläre Erkrankungen sind die Ursache für die Krümmung der Wirbelsäule.
- Osteopathische Skoliose: Die Wirbelkörper sind verformt, etwa wegen eines Bruchs nach einem Unfall oder aufgrund einer Erkrankung der Knochen.
Skoliose: Symptome
Je nach Schweregrad und Ausprägung kann die Skoliose unterschiedlich starke Symptome hervorrufen. Eine leichte Skoliose an der Brust- oder Lendenwirbelsäule (BWS, LWS) verursacht meist keine Beschwerden. Sie kann höchstens optisch auffallen.
Dagegen kann eine schwere Skoliose nicht nur schmerzhaft sein, sondern auch Folgen für die Wirbelsäule und sogar die Organe haben. Eine fortgeschrittene Skoliose kann sich auch an der Halswirbelsäule (HWS) zeigen, wenn die Fehlhaltung auch den Bereich des Nackens betrifft. Folgende Symptome können auftreten bei einer Skoliose:
- Schmerzen, meist Rückenschmerzen
- Verspannungen im Schulterbereich und Muskelschmerzen
- Einschränkungen der Beweglichkeit
- Optisch: asymmetrische Schultern, ungleiche Beckenhöhe, hervorstehendes Schulterblatt. Bei Menschen mit einer Skoliose stehen die Rippen am Rücken hervor und bilden beim Vorbeugen einen sogenannten Rippenbuckel. Diese Skoliose-Erscheinung verursacht zwar keine Schmerzen, fällt aber optisch auf. Auch am Brustkorb können einzelne Rippen hervorstehen.
- Kurzatmigkeit und Herzbeschwerden, wenn die Funktion von Lunge und Herz beeinträchtigt ist. Das passiert beispielsweise, wenn die Muskeln im Bereich des Brustkorbs verspannt oder selbiger durch die Schiefstellung verformt ist.
Viele Fragen sich bei einer Skoliose, welcher Arzt für diese Erkrankung infrage kommt. Eine gute erste Anlaufstelle ist Ihr Hausarzt, bei Kindern der Kinder- und Jugendmediziner. Möglich ist die Überweisung an einen Facharzt für Orthopädie, der auf Wirbelsäulenerkrankungen wie die Skoliose spezialisiert ist.
Skoliose: Diagnose
Ist die Skoliose ausgeprägt, sieht der Arzt auf einen Blick, dass die Wirbelsäule verkrümmt ist: Stehen Becken oder Schultern schief, befindet sich der Kopf nicht über der Beckenmitte oder ragt ein Schulterblatt stärker hervor als das andere, ist der Befund meist eindeutig. Eltern, die dies bei ihren Kindern beobachten, sollten unbedingt einen Arzt aufsuchen, damit die Behandlung der Skoliose schnell beginnen kann.
Der sogenannte Adams-Test kann den Verdacht beim Arzt bestätigen. Dabei beugt der Patient bei gestreckten Knien den Oberkörper nach vorn. Sieht der Arzt dann einen Rippenbuckel hervortreten oder muskuläre Ungleichgewichte, kann er Seitenvergleiche anstellen und Abweichungen messen.
Das Röntgen ist bei einer Skoliose der nächste Diagnoseschritt. Auf den Bildern sieht der Arzt, ob die Halswirbelsäule (HWS), Brustwirbelsäule (BWS) oder Lendenwirbelsäule (LWS) verkrümmt ist und wie stark die Biegung der Wirbelsäule in welchen Bereichen ist. Anhand des Röntgenbildes lässt sich der Cobb-Winkel bestimmen.
Eine ärztliche Therapie ist nicht bei jeder Skoliose erforderlich. Ob eine Behandlung ratsam ist, hängt vom Schweregrad, der Ursache und dem Alter des jeweiligen Betroffenen ab.
Eine leichte Verkrümmung, die keine Beschwerden bereitet, kann unbehandelt bleiben. Allerdigs beobachen Ärzte die Skoliose aktiv und kontrollieren sie in regelmäßigen Zeitabständen, meist alle vier bis sechs Monate. Verstärkt sich die Krümmung, setzen Symptome ein oder droht ein frühzeitiger Verschleiß der Wirbelsäule, beginnt die Skoliose-Behandlung.
Bei Kindern lohnt sich eine rechtzeitige Behandlung immer: Ihre Wirbelsäule wächst noch und ist formbar, zum Beispiel durch das Tragen eines Korsetts. Bei Erwachsenen ist die Wirbelsäule ausgewachsen und lässt sich nicht einfach durch ein Korsett geraderücken. Damit sich die Verkrümmung nicht verschlimmert, lässt sich eine Skoliose im Alter behandeln, etwa durch Physiotherapie. In schweren Fällen empfehlen Ärzte einen chirurgischen Eingriff.
Eine Skoliose ist nicht heilbar, aber eine Behandlung kann das Fortschreiten der Verkrümmung verlangsamen, Symptome bessern und die Lebensqualität aufrechterhalten.
Skoliose-Korsett
Bei Kindern mit Skoliose, deren Cobb-Winkel mehr als 20 Grad beträgt, lohnt sich das Tragen eines Korsetts, einer sogenannten Orthese. Ähnlich wie eine Zahnspange, die das Kieferwachstum beeinflusst, hält ein Korsett die Wirbelsäule auf Kurs und verhindert allzu starke Verformungen während des Wachstums. Die individuell angefertigte Schale besteht aus Kunststoff und sollte regelmäßig neu angepasst werden, damit sie nicht zu klein wird, wenn die kleinen Patienten wachsen. Je öfter Kinder mit Skoliose ihr Korsett tragen – am besten auch nachts –, desto vielversprechender ist der Therapieerfolg.
Je nach Höhe und Richtung der Verkrümmung bieten Orthesenhersteller bei einer Skoliose verschiedene Korsett-Arten an. Moderne Korsetts entstehen individuell anhand eines Gipsabdrucks. In der Regel tragen Erwachsene mit Skoliose kein Korsett: Ihre Wirbelsäule ist ausgewachsen und das Wachstum lässt sich nicht mehr beeinflussen.
Skoliose-OP
Bei schweren Skoliosen mit Cobb-Winkeln von mehr als 50 Grad ziehen Ärztinnen und Ärzte eine Operation in Erwägung. Durch die Skoliose-OP richten Chirurgen die Wirbelsäule gerade und versteifen bestimmte Abschnitte. Wie bei jedem operativen Eingriff bestehen bei einer Skoliose-OP Risiken und Spätfolgen; zum Besipeiel können Bewegungseinschränkungen auftreten. Sie sollte daher nur stattfinden, wenn es keine anderen Therapiemöglichkeiten gibt oder Maßnahmen wie Krankengymnastik ausgeschöpft sind.
Übungen gegen Skoliose
Bei einer Skoliose können Sie Ihre Wirbelsäule selbst durch tägliche Übungen unterstützen. Vor allem leichtere Formen (Cobb-Winkel zwischen 10 und 20 Grad) lassen sich mit gezielten Kräftigungsübungen erfolgreich stabilisieren. Das Training stärkt die Rückenmuskeln, verbessert die Körperhaltung und schützt das Herz und die Lunge.
Beispielsweise können speziell bei Skoliose Übungen aus dem Schroth-Programm hilfreich sein. Bei dem von der Gymnastiklehrerin Katharina Schroth entwickelten Training korrigieren Sie Ihre Haltung vor dem Spiegel und entwickeln so ein Bewusstsein für die Position Ihrer Wirbelsäule. Einmal erlernt, am besten mithilfe eines Physiotherapeuten, eignen sich die Skoliose-Übungen nach Schroth auch für zuhause. Es gibt auch spezielle Skoliose-Übungen für Kinder. Diese lernen die kleinen Patienten und ihre Eltern gemeinsam in der Physiotherapie.
Skoliose und Sport
Skoliose und Sport schließen sich keineswegs aus. Er ist sogar empfehlenswert, da er Rücken- und Rumpfmuskulatur stärkt. Führen Sie möglichst täglich Kräftigungsübungen für die Rücken- und Bauchmuskulatur durch und treiben Sie am besten Sport – im Rahmen Ihrer Möglichkeiten.
Geeignet sind schonende, symmetrische Sportarten, unter anderem sind das bei Skoliose:
- Yoga
- Klettern
- Nordic Walking
- Schwimmen
- Skilanglauf
- Inlineskating
- Pilates
- Eislaufen
Nicht geeignet sind dagegen alle Sportarten, die durch abrupte Bewegungen die Wirbelsäule belasten. Beispiele:
- Weitsprung
- Hochsprung
- Trampolinspringen
- Turnen
- Reiten
- Bodybuilding
Welchen Sport Sie bei einer Skoliose wie intensiv betreiben dürfen, sollten Sie mit einem erfahrenen Arzt und/oder Physiotherapeuten besprechen.
Bleibt eine schwere Skoliose unbehandelt, sind Folgeschäden möglich, zum Beispiel:
- starke Abnutzung der Wirbel und Bandscheiben – Rückenschmerzen sind die Folge, vor allem bei einer Skoliose der Lendenwirbelsäule
- Die Rippen können auf die Lunge und das Herz drücken und ihre Funktion beeinträchtigen. Kurzatmigkeit und eine verminderte Pumpleistung des Herzens sind mögliche Folgen. Auch die Funktion der Nieren und Verdauungsorgane kann gestört sein – je nach Ort der Skoliose.
Sport als Medizin (Podcast #6)
Zu Gast: Prof. Dr. Martin Halle, Direktor der Poliklinik für Präventive und Rehabilitative Sportmedizin der Technischen Universität in München
Mehr Infos zur Folge
„Zellen fahren gerne Fahrrad“, sagt Professor Martin Halle, Direktor der Poliklinik für Präventive und Rehabilitative Sportmedizin der Technischen Universität in München. Wer sich bewegt, verjüngt die Blutgefäße, beugt Krankheiten vor und kann Symptome lindern. Wie das genau funktioniert, klären wir mit dem Präventivmediziner in dieser Folge unseres Podcasts.
Wir finden heraus, wie die Wunderpille Sport am besten wirkt – also was, wie lange und wie oft man trainieren sollte, damit die Bewegung besonders heilsam ist. Und inwieweit körperliche Aktivität sogar Medikamente ersetzen kann. Wir erfahren auch, wie wir uns vor Verletzungen schützen können, ob Muskelkater gefährlich ist und wie schnell man nach einer Corona-Infektion wieder ins Training einsteigen darf.
Der Sportexperte verrät außerdem seine ganz persönlichen Motivationstricks.
Quellen
- Sk2-Leitlinie: Adoleszente Idiopathische Skoliose (Deutsche Wirbelsäulengesellschaft (DWG)); Stand: 15.03.2023
- Online-Informationen Berufsverband für Orthopädie und Unfallchirurgie e. V.: https://orthinform.de; Abruf: 16.09.2025
- Online-Informationen Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG): www.gesundheitsinformation.de; Abruf: 16.09.2025
- Online-Informationen Deutsches Skoliose Netzwerk (DSN): https://deutsches-skoliose-netzwerk.de; Abruf: 01.10.2025
- Online-Informationen Rhein Neckar Wirbelsäulenzentrums: www.rhein-neckar-wirbelsäulenzentrum.de; Abruf: 15.09.2025
- Online-Informationen Orthopädiepraxis Grunerstraße: www.orthopaedie-grunerstrasse.de; Abruf: 01.10.2025
- Online-Informationen Deutsches Skoliosezentrum: www.deutsches-skoliosezentrum.de; Abruf: 01.10.2025