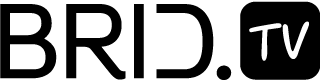© Ronny Behnert/Stock Adobe
Zusammenfassung:
- Definition: Eine Erkrankung der Netzhaut, die den gelben Fleck (Makula) betrifft. Der Bereich des schärfsten Sehens in der Mitte der Netzhaut ist beeinträchtigt; die Sehschärfe ist erheblich herabgesetzt (Schwierigkeiten zum Beispiel beim Lesen und Erkennen von Gegenständen)
- Formen und Ursachen: Es gibt hauptsächlich zwei Formen der AMD – die trockene (häufiger) und feuchte (seltener) Makuladegeneration; verschiedene Ursachen, allen voran das Alter, aber auch die Gene, Rauchen, manche Medikamente
- Symptome: herabgesetzte Sehschärfe, Gesichtsfeldausfälle, verzerrtes Sehen, Schwierigkeiten bei der Anpassung an veränderte Lichtverhältnisse
- Wann zum Arzt? Immer zeitnah bei Sehproblemen – Augenarztbesuch kann Ursachen aufdecken
- Therapie: Keine wirksame Behandlung bei trockener Makuladegeneration, verschiedene Therapien bei feuchter AMD, vor allem Medikamente (VEGF-Inhibitoren), aber auch Sehhilfen, Rauchverzicht, Vitamine und Mineralstoffe (für bestimmte Stadien)
- Diagnose und Selbsttest: Krankengeschichte erfragen, Sehtest, Amsler-Gitter-Test, Augenuntersuchungen, zum Beispiel Augenspiegelung, Fluoreszenzangiografie
- Vorbeugen: keine besonderen Maßnahmen, aber Rauchverzicht, gesunde Ernährung, Bewegung, Krankheiten (zum Beispiel Bluthochdruck) behandeln lassen, können sich günstig auswirken
- Leben mit Makuladegeneration: Therapien können feuchte Makuladegeneration bremsen, aber zunehmend vermindertes Sehvermögen im Verlauf, Sehhilfen und Selbsthilfegruppen sind oft hilfreich
Werbung
Was ist eine Makuladegeneration?
Eine Makuladegeneration ist eine Erkrankung der Netzhaut (Retina). Sie ist oft altersbedingt und heißt daher auch altersbedingte oder altersabhängige Makuladegeneration (AMD). Die Augenerkrankung betrifft die Mitte der Netzhaut mit der Stelle des schärfsten Sehens („gelber Fleck“ = Makula lutea).
Bei Menschen mit einer Makuladegeneration ist die Sicht beeinträchtigt und das Sehvermögen im Bereich des schärfsten Sehens (im zentralen Gesichtsfeld) nimmt ab. Den meisten Betroffenen fällt es zunehmend schwer, Geschriebenes zu lesen, Gesichter oder Gegenstände zu erkennen, Feinheiten wahrzunehmen oder Farben zu unterscheiden.
Ärzte unterscheiden die feuchte und die trockene Makuladegeneration. Meist betrifft diese chronische Erkrankung beide Augen. Der Grund für die Entstehung der Makuladegeneration ist eine Stoffwechselstörung im Auge, genauer gesagt im Bereich des schärfsten Sehens: der Makula.
Meist schreitet die Erkrankung weiter voran und die Sicht verschlechtert sich zunehmend. Schließlich kann die Netzhauterkrankung sogar das Augenlicht kosten und Menschen nahezu erblinden lassen. Eine Makuladegeneration ist nicht heilbar. Allerdings lässt sich das Fortschreiten der feuchten AMD mit Hilfe verschiedener Behandlungen aufhalten. Für die trockene Makuladegeneration gibt es dagegen bislang keine wirksame Behandlung.
Makuladegeneration: Häufigkeit und Alter
Die Makuladegeneration kommt im Alter häufiger vor, wie folgende Zahlen des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWIG) zeigen:
- Zwischen 65 und 75 Jahren leidet etwa eine von 100 Personen an einer altersabhängigen Makuladegeneration.
- Nach dem 85. Lebensjahr sind schon zehn bis 20 von 100 Personen betroffen.
- Die trockene AMD ist häufiger als die feuchte Form.
- In den Industrieländern ist die Makuladegeneration die häufigste Ursache für starke Sehbehinderungen bei älteren Menschen.
Netzhaut: Aufbau und Funktion
Die Makula spielt eine wichtige Rolle beim Sehen. Das menschliche Auge ist von einem Nervengewebe ausgekleidet, der Netzhaut (Retina). Sie enthält die Sehzellen. Es gibt zwei verschiedene Typen: Die Zapfen sind fürs Farbsehen zuständig, die Stäbchen hauptsächlich fürs Schwarz-Weiß-Sehen. Trifft Licht auf das Auge, wandelt die Netzhaut das Licht in Nervensignale um und leitet sie ans Gehirn weiter. So entsteht ein Bild der Umgebung.
In der Mitte der Netzhaut liegt die Makula, der gelbe Fleck. Hier sind besonders viele Sehzellen angesiedelt und liegen dicht nebeneinander. Vor allem Zapfen fürs farbige Sehen befinden sich dort. In der Makula ist auch der Stoffwechsel besonders aktiv. Die Sehzellen brauchen viel Energie oder „Treibstoff“ für ihre Tätigkeit. Dafür ist die wiederum die Aderhaut zuständig, der am stärksten durchblutete Teil des Auges. Die Aderhaut versorgt die Zellen der Makula mit Sauerstoff, Nährstoffen und Flüssigkeit.
Makuladegeneration: Formen und Ursachen
Augenärzte teilen die altersabhängige Makuladegeneration in zwei Formen ein: die trockene Makuladegeneration und die feuchte Makuladegeneration. Sie unterscheiden sich im Hinblick auf die Häufigkeit, den Verlauf (langsam oder schnell) und die Therapie. Außerdem gibt es verschiedene Stadien bei der AMD.
Trockene Makuladegeneration
Bei der trockenen Makuladegeneration werden die Zellen der Netzhaut aufgrund des gestörten Stoffwechsels und der Ablagerungen allmählich zerstört. Auch Veränderungen der Pigmente unter der Netzhaut können auftreten. Sie sind für Augenärzte oft ein erster Hinweis auf eine trockene AMD. Dieser Form kommt deutlich häufiger vor als die feuchte Form. Ungefähr 80 Prozent der altersbedingten Makuladegenerationen fallen in diese Gruppe.
Ärzte unterscheiden bei der trockenen AMD ein Früh- und Spätstadium. Kleine Ablagerungen (Druse) unter der Netzhaut sind ein Zeichen für eine Makuladegeneration im Frühstadium. Die Drusen bestehen aus Stoffwechselprodukten wie Fetten und Eiweißen, die nicht richtig abgebaut wurden. Im Frühstadium sind die Ablagerungen noch so gering, dass Betroffene kaum Einschränkungen ihrer Sehfähigkeit bemerken. Manchmal erscheinen Farben blasser als sonst oder Betroffene brauchen länger, um sich an dunklere Lichtverhältnisse zu gewöhnen.
Im Spätstadium sind die Ablagerungen so weit ausgeprägt, dass die Zellen in der Makula nicht mehr richtig mit Nährstoffen versorgt werden können und absterben. Das zentrale Sehen verschlechtert sich. Im Gegensatz zur feuchten Makuladegeneration verläuft die trockene AMD jedoch sehr langsam über viele Jahre. Sie sie führt nur wenigen Fällen zur Erblindung.
Feuchte Makuladegeneration
Bei einem kleinen Teil der Patienten entwickelt sich aus der trockenen AMD eine feuchte Makuladegeneration. Sie verläuft deutlich schneller als die trockene Form, meist innerhalb von Tagen oder Wochen. Bei der feuchten Makuladegeneration bilden sich neue Blutgefäße unterhalb der Netzhaut. Dies ist eine Reaktion auf die Ablagerungen. Durch die neu gebildeten Blutgefäße versucht der Körper, die ungenügende Versorgung der Sehzellen mit Sauerstoff und Nährstoffen auszugleichen.
Die neuen Blutgefäße wachsen in die Netzhaut hinein. Außerdem können sie porös und durchlässig werden. Dann können Blut und Flüssigkeit in die Netzhaut einsickern, diese anschwellen lassen und die Sehzellen schädigen. Diese Schwellung heißt „Makulaödem“. Manchmal führen die Blutungen auch dazu, dass die Netzhaut an den betroffenen Stellen angehoben wird. Oft vernarbt das geschädigte Gewebe in der Netzhautmitte. In der Folge sterben die Sehzellen dort ab.
Die feuchte Makuladegeneration führt relativ schnell dazu, dass Betroffene ihr zentrales Sichtfeld verlieren. Wie bei der trockenen Makuladegeneration bleibt das äußere Sichtfeld aber erhalten.
Juvenile Makuladegeneration
In sehr seltenen Fällen tritt die Makuladegeneration auch bei jüngeren Patienten auf. In diesen Fällen spricht man von einer juvenilen Makuladegeneration. Sie ist meist genetisch bedingt, vererbbar und tritt im Zusammenhang mit mehreren relativ seltenen Erkrankungen auf.
Ein Beispiel ist Morbus Stargardt. Mit etwa 8.000 Betroffenen in Deutschland ist die Erkrankung die häufigste Form der juvenilen Makuladegeneration. Weitaus seltener sind andere Formen, beispielsweise Morbus Best. Die Krankheiten führen ebenfalls zu Einschränkungen im zentralen Sichtfeld, sind aber noch nicht genügend erforscht.
Makuladegeneration: Ursachen und Risikofaktoren
Die Ursache der altersabhängigen Makuladegeneration ist ein gestörter Stoffwechsel in der Netzhaut. Es bilden sich Abfallprodukte, die der Körper nicht wie sonst abbauen und beseitigen kann. Zudem entstehen kleine Ablagerungen (Drusen), welche die Versorgung der Netzhaut mit Blut, Sauerstoff und Nährstoffen behindern.

© O. Aksonov
Trockene Makuladegeneration: Abhängig von Anzahl und Größe der Ablagerungen (Drusen), entwickelt sich die Spätform der trockenen AMD. Sinneszellen und Gewebe im Bereich der Drusen könnne ihre Funktion immer schlehter erfüllen und sterben ab
Die Prozesse, die bei der Entstehung der Makuladegeneration eine Rolle spielen, lassen sich so beschreiben:
- Die Stoffwechselprodukte, die bei der Tätigkeit der Zellen anfallen, werden von einer Gewebeschicht zwischen Makula und Aderhaut abgebaut, dem sogenannten Pigmentepithel. Es dient als eine Art „Müllabfuhr“.
- Funktioniert dieser Abtransport der Schadstoffe nicht mehr richtig, lagern sich Fette und Eiweiße (Proteine) im Pigmentepithel ab.
- Diese Ablagerungen beeinträchtigen den Stoffwechsel so sehr, dass die Sehzellen nicht mehr richtig arbeiten können.
- Mit der Zeit sterben Sehzellen im Bereich der Makula ab und das zentrale Sehen verschlechtert sich. Die Folge: Die Mitte des Sichtfeldes verschwimmt oder verschwindet hinter einem dunklen Fleck – je nach Stadium und Ausprägung der Makuladegeneration. Das äußere Sichtfeld bleibt dabei meist unbeschadet, weil die Makula nur für das zentrale Sehen zuständig ist. Betroffene können beispielsweise die Umrisse einer Uhr erkennen, jedoch nicht die Uhrzeit.
Eine Makuladegeneration kann verschiedene Ursachen haben. Der Name „altersbedingte Makuladegeneration“ weist auf den größten Risikofaktor für die AMD hin – nämlich das Alter. Bei den Betroffenen verschlechtert sich das Sehvermögen und die Sehkraft nimmt ab (unter zwei Prozent). Die meisten erblinden allerdings nie vollständig, sondern sie können noch Umrisse erkennen. Ein Mensch mit einer solch geringen Sehkraft gilt jedoch nach dem Gesetz als blind. Die Makuladegeneration wird als Haupterblindungsursache im Alter eingestuft. Sie ist in Deutschland die häufigste Ursache für den Bezug von Blindengeld.
Für die altersbedingte Makuladegeneration sind weitere Risikofaktoren bekannt. So können zum Beispiel erbliche Faktoren (Gene) eine Makuladegeneration begünstigen. Wenn enge Verwandte schon an einer AMD erkrankt sind, haben Familienmitglieder ein erhöhtes Risiko, selbst zu erkranken. Manchmal ist also die Makuladegeneration vererbbar.
Auch Rauchen gilt als Risikofaktor für die Makuladegeneration. Raucher erkranken im Schnitt häufiger und früher als Nichtraucher. Ob Bluthochdruck (Hypertonie), ein erhöhter Body-Mass-Index (BMI) mit Übergewicht oder Fettleibigkeit (Adipositas) oder die Irisfarbe (je weniger Irispigment, desto heller und blauer ist die Augenfarbe) eine Rolle spielen, ist laut der Leitlinie „Altersbedingte Makuladegeneration“ noch fraglich. Es gibt aber Vermutungen, dass sie daran beteiligt sein könnten.
Medikamente spielen in manchen Fällen ebenfalls eine Rolle. Bekannt ist die Makuladegeneration als Nebenwirkung von Chloroquin, das beispielsweise zur Malariaprophylaxe und zur Rheumatherapie eingesetzt wird. Auch Präparate mit dem Wirkstoff Fingolimod, die zur Behandlung von Multipler Sklerose eingesetzt werden, können ein Makulaödem auslösen.
Werbung
Makuladegeneration: Symptome
Es gibt mehrere Symptome, durch die sich eine Makuladegeneration bemerkbar macht. Die Sehstörungen können allerdings bei jedem Betroffenen individuell verschieden sein. Oft ist zunächst nur ein Auge betroffen, während das andere voll funktionsfähig ist. Wahrnehmungseinschränkungen fallen dann zu Beginn weniger auf.
Erste Symptome einer Makuladegeneration können sein:
- Die Sehschärfe ist herabgesetzt. Gegenstände oder Worte auf einer Schriftseite erscheinen verschwommen oder verzerrt.
- Gerade Linien können plötzlich krumm oder gebogen sein (Metamorphopsien).
- Farben wirken blasser.
- Die Anpassung an veränderte Lichtverhältnisse ist erschwert (Beispiel Übergang helles Sonnenlicht in dunkles Zimmer).
- Gesichtsfeldausfälle: Im fortgeschrittenen Stadium, wenn die zentrale Sehschärfe immer weiter schwindet, sind Dinge oder Gegenstände überhaupt nicht mehr erkennbar. Das Zentrum des Blickfeldes erscheint leer oder als grauer Fleck. Gegenstände am Rand des Gesichtsfeldes sind meist noch sichtbar, aber nicht gut zu erkennen.
Makuladegeneration: Wann zum Arzt?
Sie sollten immer zeitnah eine Augenarztpraxis aufsuchen, wenn Sie Probleme mit dem Sehen haben. Es gibt viele verschiedene Erkrankungen, die mit Sehstörungen einhergehen können. Durch eine ärztliche Untersuchung lässt sich die Ursache feststellen. Es kann eine Makuladegeneration dahinterstecken, aber auch eine andere Augenkrankheit. Beispielsweise eine Kurz- und Weitsichtigkeit oder ein Grauer Star oder Grüner Star.
Video: Makuladegeneration - Ursache, Symptome und Früherkennung
Siegfried Priglinger, ärztlicher Direktor der Augenklinik der Ludwig-Maximilians-Universität München, erläutert im Video die Ursachen und Symptome der Makuladegeneration und erklärt, mit welchem Selbsttest Sie eine Makuladegeneration rechtzeitig erkennen können.
Lesen Sie hier das Videotranskript
Video-Transkript: Makuladegeneration – Ursache, Symptome und Früherkennung
Bei der Makuladegeneration kommt es zu einer Schädigung der Makula. Die Makula ist verantwortlich für das zentrale Sehen. Die Makula beschreibt eine Stelle der Netzhaut im Zentrum des Gesichtsfeldes. In der Mitte von der Makula ist die Fovea. Dort ist die höchste Dichte der Photorezeptoren und mit der Fovea können wir Lesen und ganz kleine Details wahrnehmen.
Die Ursache für die Makuladegeneration ist eine Schädigung der sogenannten retinalen Pigmentepithelzellen, die verantwortlich sind für die Ernährung der Photorezeptoren. Wenn die Photorezeptoren im Zentrum des Sehens defekt sind, dann haben wir dort einen Gesichtsfeldausfall.
Wir unterscheiden zwischen zwei Formen der Makuladegeneration: Die sogenannte trockene und feuchte Makuladegeneration. Die meisten Patienten haben eine trockene Makuladegeneration und aus dieser Trockenen kann in seltenen Fällen eine feuchte Makuladegeneration entstehen. Ganz selten, dass quasi primär eine Feuchte entsteht, ohne dass vorher eine Trockene war.
Bei der feuchten Makuladegeneration, die Gott sei Dank selten auftritt, kommt es neben der Schädigung der retinalen Pigmentepithelzellen zu einer Entstehung von Gefäßneubildungen. Diese Gefäße sind sehr brüchig und sehr häufig tritt da Flüssigkeit aus, im schlimmsten Fall kommt es zu Einblutungen.
Bei der trockenen Makuladegeneration kommt es zu einer Degeneration der retinalen Pigmentepithelzellen gefolgt von einer Schädigung der Photorezeptoren, ohne das Auftreten von neuen Gefäßen. Diese Erkrankung schreitet langsamer fort, als die feuchte Form und hat als erstes Zeichen eine zentrale Sehverschlechterung mit kleinen Gesichtsfelddefekten. Manchmal sehen die Patienten auch ein bisschen verzerrt und verzogen, aber letztlich ist sie eine eher langsam fortschreitende Erkrankung, im Vergleich zur feuchten Makuladegeneration.
Neben der Untersuchung beim Augenarzt ist die Selbstkontrolle bei der Makuladegeneration ganz wichtig. Dazu gibt es das sogenannte Amsler-Netz, was letztlich nichts anderes ist als ein Gitter. Also es ist ein Gitternetz, das man sich aufmalen kann und das regelmäßig von den betroffenen Patienten betrachtet werden sollte.
Wichtig ist, dass immer ein Auge geschlossen wird und man nur mit einem Auge auf das Gitternetz sieht. Typischerweise hat man dazu einen kleinen Punkt, den man fixiert im Zentrum des Gitternetzes und wenn um diesen Punkt herum die Linien nicht mehr gerade, sondern gewellt sind, dann ist es ein Zeichen, dass die Makuladegeneration voranschreitet.
Neben diesen Wellen kann man auch zentrale Gesichtsfelddefekte feststellen. Für die Patienten ist wichtig sich zu merken: "Wie war das vorher und hat sich was verändert?". Wenn eine Veränderung auftritt, dann sollte man kurzfristig zum Augenarzt gehen.
Sollten sie kein Amsler-Netz zur Verfügung haben, dann ist auch die Möglichkeit, dass man sich am Fenstergitter zum Beispiel orientiert oder bei den Schränken, bei den Schranktüren, die sind ja auch alle gerade und machen natürlich auch ein Gitter. Auch hier kann man diese Verzerrungen dann feststellen. Den Amsler-Selbsttest kann man sowohl zur Früherkennung verwenden, aber natürlich auch zur Verlaufskontrolle.
Werbung
Makuladegeneration: Therapie
Die Therapie der Makuladegeneration hängt von der Form und vom Stadium ab. Eine trockene altersbedingte Makuladegeneration lässt sich derzeit noch nicht wirkungsvoll behandeln. Forschende untersuchen aber verschiedene Therapien in Studien. Für die feuchte Makuladegeneration gibt es dagegen einige Behandlungen.
Ziel der AMD-Behandlung ist es, eine Sehverschlechterung und eine Erblindung zu vermeiden. Ärzte klären Sie umfassend über das Krankheitsbild, den wahrscheinlichen Krankheitsverlauf, die Therapiemöglichkeiten und die zu erwartenden Effekte der Behandlungen auf. Außerdem erhalten Sie Informationen, wie Sie Ihr zentrales Gesichtsfeld selbst kontrollieren können, zum Beispiel mit Hilfe der Amsler-Karte (siehe Abschnitt „Diagnose und Selbsttest“). Eine feuchte Makuladegeneration ist nicht heilbar, aber der Verlauf lässt sich verlangsamen und das Fortschreiten aufhalten.
Video: Behandlung der Makuladegeneration
Siegfried Priglinger, ärztlicher Direktor der Augenklinik der Ludwig-Maximilians-Universität München, erläutert im Video, wie Ärzte die feuchte Makuladegeneration behandeln können. Und: Welche Möglichkeiten es gibt, bei der trockenen Form der Makuladegeneration zumindest die Symptome zu verbessern – denn die trockene Makuladegeneration ist bisher nicht behandelbar.
Lesen Sie hier das Videotranskript
Video-Transkript: Behandlung der Makuladegeneration
Die Makuladegeneration ist leider nicht heilbar. Was wir heute machen können, ist den Verlauf zu stoppen oder zumindest zu verlangsamen.
Man muss da unterscheiden zwischen der trockenen und der feuchten Form der Makuladegeneration.
Die trockene Makuladegeneration kann man nicht behandeln. Da gibt es leider Gottes aktuell noch keine Möglichkeit mit Medikamenten den Verlauf zu stoppen oder die Geschwindigkeit der Verschlechterung zu reduzieren, sie hat natürlich den Vorteil, dass sie deutlich langsamer verläuft, als die feuchte Makuladegeneration.
Bei der feuchten Makuladegeneration weiß man, dass bestimmte Wachstumsfaktoren verantwortlich sind für die Entstehung dieser neuen Gefäße. Entsprechend gibt es heutzutage Spritzen, wo man Antikörper gegen diese Wachstumsfaktoren ins Auge eingibt, und wenn man das wiederholt macht, kann man die Wirkung dieses Wachstumsfaktors hemmen, diese Gefäße bilden sich zurück, die Flüssigkeitseinlagerung geht zurück, die Wellen werden weniger und die Sehschärfe wieder besser.
Das Ziel der Behandlung ist, dass man die Anzahl der Spritzen auf ein erträgliches Maß für die Patienten reduziert. Während man am Anfang alle vier Wochen spritzen muss, kann man das Intervall dann verlängern und bei manchen Patienten reichen dann drei bis vier Spritzen pro Jahr.
Da es bei der trockenen Form der Makuladegeneration noch keine kurative Behandlung gibt, hat man letztlich nur die Möglichkeit die Symptome zu verbessern durch sogenannte "vergrößernde Sehhilfen". Mit den vergrößernden Sehhilfen versucht man mit speziellen optischen Mitteln, das Sehfeld zu vergrößern, damit trotz der schlechten Sehschärfe noch gelesen werden kann. Sehhilfen, die beleuchtet sind, die einen Vergrößerungsfaktor haben, sind natürlich dann für Patienten mit Makuladegeneration nochmal hilfreicher und heutzutage gibt es auch Systeme, wo mit Hilfe von Computersystemen das Bild so stark vergrößert wird, auf einen Monitor projiziert wird und dann ein sehr, sehr großes Bild von einem Patienten mit Makuladegeneration noch gelesen werden kann.
Die Makuladegeneration ist die häufigste Ursache der Sehverschlechterung in der westlichen Welt. Neben der genetischen Komponente ist der Lebenswandel hier auch entscheidend. Ein ganz wichtiges Risiko ist hier auch das Rauchen. Also man sollte möglichst nicht rauchen. Wie genau der Mechanismus funktioniert ist nicht geklärt, aber letztlich ist auch die Durchblutung entscheidend und ein schlechter kardiovaskulärer Status ist auch bei einer Makuladegeneration kein Vorteil.
Eine gesunde Ernährung ist sinnvoll. Es gibt Vitaminpräparate für die Makuladegeneration, da muss man aber ganz klar sagen, dass hier der bunte Teller beim Essen alleine schon genügend Vitamine mit sich bringt. Ganz selten, dass spezielle Kombinationen bei bestimmten Formen der Makuladegeneration tatsächlich gezeigt haben, dass es das Risiko der Verschlechterung des zweiten Auges reduziert.
Ich würde rein aus prophylaktischen Gründen, wenn jemand noch keine Makuladegeneration hat, keine Vitaminpräparate nehmen. Nur wenn der Augenarzt dazu rät – bei bereits vorhandener Makuladegeneration – macht sowas Sinn.
Medikamente bei Makuladegeneration: VEGF-Inhibitoren
Im Verlauf der feuchten Makuladegeneration entstehen neue Blutgefäße unter der Netzhaut im Bereich der Makula, die dafür sorgen, dass die Netzhautmitte anschwillt. Für das Wachstum der Blutgefäße ist der Botenstoff VEGF (engl. „vascular endothelial growth factor“) verantwortlich. Bei Menschen mit einer feuchten Makuladegeneration wird dieser Botenstoff übermäßig produziert.
VEGF-Inhibitoren oder VEGF-Hemmer sind Medikamente, die bei einer Makuladegeneration helfen können. Die Medikamente werden als Spritzen unter örtlicher Betäubung ins Auge (den Glaskörper) injiziert. Die Behandlung heißt „Intravitreale Operative Medikamenteneingabe" (IVOM). Sie können die Therapie ambulant in der Arztpraxis durchführen lassen. VEGF-Inhibitoren hemmen die Neubildung von Blutgefäßen. Außerdem dichten sie die durchlässigen Gefäße ab, sodass keine Flüssigkeit mehr austreten kann.
Diese Medikamente sind die wichtigste Behandlungsmöglichkeit bei einer Makuladegeneration. Zum Einsatz kommen zum Beispiel die Wirkstoffe Aflibercept, Brolucizumab, Faricimab und Ranibizumab. Manchmal wird auch ein Wirkstoff aus der Krebstherapie (off-label = ohne Zulassung für die AMD) angewendet. Die Medikamente können die Netzhauterkrankung zwar nicht heilen, aber bremsen. Bei manchen verbessert sich die Sehschärfe durch die Medikamente sogar wieder. VEGF-Hemmer wirken bei einer Makuladegeneration allerdings nur für einen begrenzten Zeitraum. Daher sind mehrere Spritzen in bestimmten Abständen nötig.

Weitere Therapien bei Makuladegeneration
Diese weiteren Maßnahmen können bei einer Makuladegeneration zum Einsatz kommen:
- Sehhilfen verwenden: Vergrößernde Sehhilfen, elektronische Vorlesegeräte oder Computer mit Sprachausgabe
- Verzicht auf das Rauchen: Wenn Sie Raucher sind, versuchen Sie den Rauchstopp. Davon profitieren sowohl der Körper als auch Ihre Augen.
- Mineralstoffe und Vitamine einnehmen: Die tägliche Einnahme als Nahrungsergänzungsmittel kann sich eventuell bei bestimmten Stadien der Makuladegeneration günstig auswirken. Bei einer AMD im fortgeschrittenen Frühstadium könnten bestimmte Mineralstoffe und Vitamine womöglich die Entwicklung von Spätstadien verzögern, schreibt der Verband pro Retina e.V. Auch die Zufuhr von Lutein und/oder Zeaxanthin (beides sind Carotinoide) könne die Netzhaut möglicherweise schützen. Allerdings nehme jeder Mensch diese Substanzen unterschiedlich auf. Unklar sei es auch, ob die ausreichende Aufnahme dieser Substanzen über die Nahrung (z.B. grünes Blattgemüse) genüge oder ob zusätzliche Nahrungsergänzungsmittel hilfreich seien.
- Operation (Makulachirurgie): Eine Operation bei Makuladegeneration ist nur in Einzelfällen bei Einblutungen in die Netzhaut notwendig, wenn Medikamente nicht ausreichend wirksam sind.
Zur gezielten Ernährung bei einer Makuladegeneration gibt es derzeit keine Empfehlungen, weil verlässliche Daten aus Studien fehlen. Allgemein ratsam ist aber eine gesunde, ausgewogene und vielfältige Ernährung mit vielen Vitaminen und Mineralstoffen (zum Beispiel Obst, Gemüse, Vollkorkprodukte).
Frühere Behandlungen der feuchten AMD haben sich als weniger wirksam erwiesen. Sie kommen heute nur noch in Ausnahmefällen zum Einsatz. Beispiele:
- Laserkoagulation von Gefäßneubildungen: Die neuen Gefäße werden mittels Laser verödet.
- Photodynamische Therapie (PDT): Eine lichtempfindliche Substanz wird in die Armvene injiziert. Mit dem Blutstrom gelangt der Stoff auch zur Netzhaut des Auges. Danach wird das Auge wird mit einem Rotlichtlaser bestrahlt und der Wirkstoff wird auf diese Weise aktiviert. So sollen veränderte Blutgefäße verschlossen werden.
- Chirurgische Verfahren: Hierzu gehören die Netzhaut-Glaskörper-Operation mit einer Rotation der Netzhaut.
- Die Transplantation von Zellen der Pigmentschicht der Netzhaut.
- Eine Strahlentherapie zur Behandlung der Makuladegeneration nehmen Ärzte heute nicht mehr vor.
Makuladegeneration: Diagnose und Selbsttest
Die Diagnose „Makuladegeneration“ kann ein Augenarzt stellen. Er stellt Ihnen zunächst einige Fragen zu Ihrer Krankengeschichte (Anamnese), zum Beispiel:
- Welche Symptome und Sehprobleme haben Sie?
- Wann haben Sie diese erstmals bemerkt?
- Wie stark sind diese ausgeprägt?
- Haben sich die Sehschwierigkeiten zwischendurch gebessert oder kontinuierlich verschlechtert?
- Sind Krankheiten bei Ihnen bekannt? Falls ja: welche?
- Nehmen Sie Medikamente ein? Wenn ja: Welche?
- Ist eine Makuladegeneration in Ihrer Familie bekannt?
- Rauchen Sie? Wie viel und seit wann?
Im Rahmen der Diagnose gilt es auch, andere Krankheiten als Ursachen für die Sehprobleme auszuschließen. Anschließend untersucht der Augenarzt Ihr Auge nach Veränderungen und Auffälligkeiten, besonders in der Netzhautmitte. Dort lassen sich Ablagerungen der Stoffwechselprodukte erkennen. Eine Makuladegeneration lässt sich so schon feststellen, bevor Sie Einschränkungen im Sehen bemerken.
Verschiedene Verfahren kommen bei der Diagnose einer Makuladegeneration zum Einsatz. Die wichtigsten sind:
- Sehtafel: Eine Untersuchung des Sehvermögens (zum Beispiel Sehschärfe) mit Hilfe von Sehzeichen auf der klassischen Sehtafel. Sie kommt auch bei normalen Sehtests zum Einsatz.
- Amsler-Gitter-Test: Das sogenannte Amsler-Netz ist ein kariertes Quadrat (ähnlich einem karierten Rechenpapier) mit einem Punkt in der Mitte. Mit diesem Test lassen sich typische Beschwerden der Makuladegeneration aufspüren (siehe auch Kasten zum „Selbsttest“).
- Augenspiegelung (Ophthalmoskopie): Die Methode dient der Untersuchung des Augenhintergrundes und kann eine Makuladegeneration schon im Frühstadium aufdecken. Dabei wird die Netzhaut im hinteren Teil des Auges beleuchtet. Die Makula und die versorgenden Blutgefäße sind sichtbar. Dafür leuchtet der Augenarzt den Patienten von vorne ins Auge. Meist werden vor der Untersuchung die Pupillen durch Medikamente geweitet. Der Augenarzt schaut mit Hilfe eines Vergrößerungsinstruments durch die geweiteten Pupillen ins Auge und kann so mögliche Veränderungen erkennen. Die Augenspiegelung verursacht keine Schmerzen und birgt nur geringe Risiken.
- Fluoreszenzangiografie: Dies ist eine Untersuchung der Gefäße mit Hilfe eines Farbstoffs, der in die Armvene injiziert wird und über den Blutstrom auch ins Auge gelangt. Abnormale Gefäße im Augenhintergrund lassen sich mittels Fluoreszenzangiografie darstellen.
- Optische Kohärenztomografie (OCT): Ärzte können die Struktur der Netzhaut, einen Gewebeschwund (Atrophie) und das Pigmentepithel der Netzhaut beurteilen. Strukturveränderungen wie Drusen oder Flüssigkeitsansammlungen in oder unter der Netzhaut lassen sich so aufspüren.
- Fundusautofluoreszenz (FAF) und Nah-Infrarot-Autofluoreszenz (NIA): Sie können schon frühzeitig Veränderungen des Pigmentepithels der Netzhaut zeigen. Vor allem ein Gewebeschwund lässt sich gut erkennen.
Einige dieser Methoden eignen sich auch, um den Verlauf einer Makuladegeneration zu kontrollieren.
Makuladegeneration: Test mittels Amsel-Gitter
Diesen Test mit dem Amsler-Netz können Sie auch als Selbsttest auf eine Makuladegeneration zu Hause durchführen: https://www.dbsv.org/amsler-gitter-test.html.
- Schauen Sie im normalen Leseabstand auf das Netz. Wenn nötig, tragen Sie dabei Ihre Lesebrille.
- Bedecken Sie ein Auge.
- Schauen Sie direkt auf das Zentrum des Netzes mit dem schwarzen Punkt.
- Achten Sie nun darauf, ob alle Linien des Netzes gerade sind oder ob sie in bestimmten Bereichen verzerrt, verschwommen oder unscharf sind.
- Wiederholen Sie diesen Vorgang mit dem anderen Auge.
- Wenn Linien krumm erscheinen oder verborgen sind, sollten Sie Ihren Augenarzt aufsuchen. Das gilt auch, wenn Sie sich unsicher sind.
Wiederholen Sie den Test in regelmäßigen Abständen, um Veränderungen festzustellen. Vielleicht drucken Sie das Amsler-Netz aus und heften es als Erinnerungshilfe an den Kühlschrank, die Pinnwand oder die Tür.
Werbung
Makuladegeneration vorbeugen
Es gibt keine speziellen Maßnahmen, mit denen Sie einer Makuladegeneration sicher vorbeugen können. Besonders wichtig ist jedoch die Früherkennung, weil Raucher auf das Rauchen verzichten und somit das Fortschreiten der Makuladegeneration bremsen können. Außerdem können Ärzte rasch mit der Behandlung der Makuladegeneration beginnen, wenn sie rechtzeitig diagnostiziert wird. Sie lässt sich oft aufhalten, zum Beispiel mit Medikamenten.
Studien (AREDS-Studien) legen nahe, dass Antioxidantien und Vitamine (Lutein und Zeaxanthin) als Nahrungsergänzungsmittel den Verlauf der altersbedingten Makuladegeneration bremsen können. Es gibt aber bislang keine spezielle Ernährung bei Makuladegeneration, die Experten allgemein empfehlen könnten.
Manche Risikofaktoren für die Makuladegeneration können Sie selbst beeinflussen, um diese bis zu einem gewissen Maß vorzubeugen. Dazu gehört zum Beispiel der Verzicht aufs Rauchen. Auf andere Risikofaktoren haben Sie dagegen keinen Einfluss, etwa das Alter oder die Gene.
Einige allgemeine Tipps zum Schutz Ihrer Augen:
- Versuchen Sie den Rauchstopp: Rauchen gilt als Risikofaktor für die Makuladegeneration, denn es verengt die Gefäße und vermindert den Blutfluss. Dies betrifft auch die kleinen Gefäße im Auge. Für den körperlichen Entzug können ein schrittweises Reduzieren des Nikotinkonsums oder Nikotinersatzprodukte hilfreich sein. Eine Verhaltenstherapie kann die dauerhafte Abstinenz unterstützen.
- Ernähren Sie sich möglichst gesund und ausgewogen: Essen Sie täglich viel frisches Obst und Gemüse sowie Vollkornprodukte. Sie enthalten viele Vitamine und Mineralstoffe. Besprechen Sie mit Ihrem Arzt, ob Nahrungsergänzungsmittel in Ihrem Fall sinnvoll sind, um die Erkrankung zu verzögern.
- Schützen Sie Ihre Augen vor UV-Strahlung: Tragen Sie eine geeignete Sonnenbrille mit entsprechendem UV-Schutz.
- Bewegen Sie sich regelmäßig: Machen Sie täglich einen halbstündigen Spaziergang oder treiben Sie am besten Sport. Davon profitiert Ihr gesamter Körper.
- Wenn Sie unter der Diabetes mellitus leiden: Achten Sie auf gut eingestellte Blutzuckerwerte. Zu hohe Zuckerwerte im Blut können langfristig die Gefäße schädigen, auch jene der Netzhaut.
- Bluthochdruck (Hypertonie) sollten Sie ausreichend behandeln lassen: Es gibt Medikamente, aber auch eine gesunde Ernährung und viel Bewegung können bei Bluthochdruck helfen.
Siegfried Priglinger, ärztlicher Direktor der Augenklinik der Ludwig-Maximilians-Universität München, gibt Tipps, wie Sie Ihre Augen möglichst lange gesund halten.
Lesen Sie hier das Videotranskript
Was kann man eigentlich machen, um die Augen jetzt sozusagen möglichst lange gesund zu halten? Da gibt’s so Dinge wie zum Beispiel UV-Schutz, der ist wichtig für die Hornhaut, aber vor allem auch für die Netzhaut. Stichwort: Prophylaxe der altersbedingten Makuladegeneration. Ernährung ist wichtig. Da ist aber jetzt nicht notwendig, dass Sie irgendwelche Vitaminpräparate nehmen, sondern möglichst eine gesunde, ausgewogene Ernährung. Man sagt immer: ein möglichst bunter Teller. Also, sprich: Gemüse, wenig Fett, Fleisch in Maßen, das ist entscheidend.
Und was natürlich auch entscheidend ist und wichtig, ist das Rauchen. Man weiß, dass viele Erkrankungen mit dem Rauchen assoziiert sind, zum Beispiel die altersbedingte Makuladegeneration. Neben der genetischen Prädisposition ist das Rauchen ein großer Risikofaktor. Dass also Raucher viel häufiger Makuladegeneration haben als Leute, die nie geraucht haben.
Wenn man Vorsorge leisten möchte, dann ist eine regelmäßige Untersuchung beim Augenarzt wichtig. Denn es gibt Augenerkrankungen, wie zum Beispiel der Grüne Star, wo wir gar nicht merken, dass wir krank sind und der Augendruck keine Schmerzen bereitet. Das kann nur der Augenarzt feststellen. Also ist eine prophylaktische Untersuchung beim Augenarzt ab dem 40. oder 45. Lebensjahr sehr wichtig.
Leben mit der Makuladegeneration
Eine feuchte Makuladegeneration ist eine chronische Erkrankung, die sich zwar aufhalten, aber nicht heilen lässt. Trotz Behandlungen müssen Sie damit rechnen, mit der Zeit einen Teil Ihrer Sehkraft einzubüßen und mit einer Sehbehinderung zu leben. In der Regel bleibt jedoch immer ein Teil der Sehkraft erhalten, zumindest das äußere Sichtfeld. Auch wenn im späten Stadium der Makuladegeneration die zentrale Sehschärfe größtenteils verloren geht, reicht die verbleibende Sehkraft meist aus, um im Alltag selbstständig zurechtzukommen.
Wichtige Tipps für das Leben mit Makuladegeneration:
- Sehhilfen: Sie können bei einer Makuladegeneration eine gute Unterstützung sein. Das sind Hilfsmittel, mit denen kleine Arbeiten und das Lesen wieder möglich werden. Beispiele: Lupen, Lupenbrillen oder Fernrohr- und Prismenlupenbrillen, die das Sichtfeld optisch vergrößern. Auch elektronische Sehhilfen können helfen. Dabei handelt es sich um Geräte, die einen Bereich elektronisch vergrößern und auf einem Bildschirm darstellen.
- Selbsthilfegruppe: Der Kontakt zu einer Selbsthilfegruppe kann bei einer Makuladegeneration eine große Hilfe sein. Das AMD-Netz vermittelt regionale Ansprechpartner und Selbsthilfegruppen (www.amd-netz.de). Dort treffen Sie auf Menschen, denen es ähnlich ergeht wie Ihnen. Sie können sich miteinander austauschen und Rat und Unterstützung erhalten.
- Sich anderen mitteilen: Der offene Umgang mit der Makuladegeneration kann Ihren Alltag erleichtern. Sagen Sie Ihrem Umfeld (Familie, Bekannte, Freunde, Arbeitskollegen), wenn Sie Hilfe brauchen. Kommunizieren Sie auch, wenn Sie Schwierigkeiten haben, Gesichter zu erkennen. Dann lassen sich unangenehme Situationen im Alltag vermeiden. Scheuen Sie sich auch nicht, beim Einkaufen oder beim Lesen eines Fahrplans nach Hilfe zu fragen.
- Auf das eigenständige Autofahren müssen die meisten Menschen mit einer Makuladegeneration verzichten (bzw. ist es nur als Beifahrer möglich). Aufgrund der Sehprobleme kann das Autofahren für Sie selbst und für andere gefährlich werden.
- Ein spezielles Bewegungstraining kann Ihnen dabei helfen, Ihre Orientierungsfähigkeit zu verbessern, etwa beim Einkaufen, Kochen oder in der Freizeit.
- Wenn Ihre zentrale Sehschärfe sehr stark gemindert ist (höchstens zwei Prozent Sehkraft), haben Sie einen Anspruch auf Blindengeld. Das gilt auch, wenn Sie nicht komplett erblindet sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie beim Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband e.V. (DBSV) unter: www.dbsv.org/
Quellen
- Leitlinie Nr. 21: Altersabhängige Makuladegeneration (AMD) (Berufsverband der Augenärzte Deutschlands e.V. und Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft); Stand: 11.12.2023
- Keenan, T D L et al.: Oral Antioxidant and Lutein/Zeaxanthin Supplements Slow Geographic Atrophy Progression to the Fovea in Age-Related Macular Degeneration Ophthalmology; American Academy of Ophthalmology; 2025; DOI: 10.1016/j.ophtha.2024.07.014
- Online-Informationen Berufsverband der Augenärzte Deutschlands e.V.: Makuladegeneration: www.augeninfo.de; Abruf: 27.01.2025
- Online-Informationen Berufsverband der Augenärzte Deutschlands e.V.: Die altersabhängige Makuladegeneration (AMD): www.augeninfo.de; Abruf: 27.01.2025
- Online-Informationen Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWIG): www.gesundheitsinformation.de; Abruf: 27.01.2025
- Online-Informationen Pro Retina. Fakten zur AMD: www.pro-retina.de; Abruf: 28.01.2025
- Online-Informationen Pro Retina. Fakten zu HJMD: www.pro-retina.de; Abruf: 28.01.2025
- Online-Informationen AMD-Netz: www.amd-netz.de; Abruf: 28.01.2025
Werbung