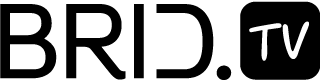© Shutterstock
Zusammenfassung:
- Definition: Eine funktionelle Störung des Darms, für die sich keine organische Ursache finden lässt. Heißt auch Reizdarmsyndrom, Reizkolon, Colon irritable oder nervöser Darm. Kann unterschiedlich stark ausgeprägt sein und den Alltag und die Lebensqualität beeinträchtigen. Frauen sind öfter betroffen als Männer.
- Symptome: Bauchschmerzen, Bauchkrämpfe, Blähungen, Durchfall, Verstopfung, veränderter Stuhlgang (z. B. häufiger, seltener).
- Behandlung: Meist Kombination aus mehreren Behandlungsansätzen, zum Beispiel Medikamente, Ernährung, Probiotika, pflanzliche Stoffe (zum Beispiel Ballaststoffe), Entspannungstechniken, Bewegung, Psychotherapie, Hypnose.
- Ursachen: Noch nicht genau aufgeklärt, aber vermutlich spielen mehrere Faktoren zusammen (biologische, psychische, soziale); verantwortlich für den Reizmagen sind vermutlich gestörte Darmbewegungen, überempfindliche Darmnerven, veränderte Darmflora, Darminfektionen, Entzündungen, erbliche Veranlagung, Stress.
- Diagnose: Es gibt keine Untersuchung, um Reizdarm sicher nachzuweisen. Diagnostik durch Erfassen der Krankengeschichte, körperliche Untersuchung, Stuhluntersuchung, Blutwerte, Ultraschall des Bauchs, Darmspiegelung – hilft, andere Erkrankungen als Ursache auszuschließen.
- Welcher Arzt? Erst Hausarzt, dann bei Verdacht Facharzt für Gastroenterologie; bei Kindern: Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin.
- Dauer und Verlauf: Lassen sich nicht genau vorhersagen, sind individuell verschieden; meist ist Reizdarm chronisch und verläuft in Schüben (Phasen mit und ohne Beschwerden); viele können aber dank Therapien und Lebensstilmaßnahmen ein weitgehend normales Leben führen.
- Folgen: Keine Schäden an den Organen und normale Lebenserwartung; kann aber Folgen wie Gewichtsverlust oder soziale Isolation mit sich bringen.
Werbung
Was ist ein Reizdarm?
Der Reizdarm – auch Reizdarmsyndrom (RDS) genannt – gehört zu den funktionellen Magen-Darm-Erkrankungen. Ärzte verstehen darunter eine Funktionsstörung im Darm, für die sich mit Hilfe „normaler“ Untersuchungsmethoden keine organische Ursache finden lässt. Andere Fachbegriffe für das Reizdarmsyndrom sind Reizkolon, Colon irritabile, „nervöser Darm“ oder Englisch Irritable Bowel Syndrome (IBS).
Auch der Reizmagen gehört zur Gruppe der funktionellen Magen-Darm-Störungen.
Das Reizdarmsyndrom kann bei Betroffenen sehr unterschiedlich ausgeprägt sein. Die Symptome wie Bauchschmerzen, Bauchkrämpfe, Blähungen und ein veränderter Stuhlgang können individuell verschieden intensiv ausfallen. Auch der Verlauf und die Beeinträchtigungen im Alltag können unterschiedlich sein.
Wie häufig das Reizdarmsyndrom in der Bevölkerung ist, lässt sich nicht genau beziffern. Schätzungen zufolge haben ungefähr 10 bis 20 von 100 Menschen ein Reizdarmsyndrom. Die Zahlen, die in Studien ermittelt wurden, liegen oft weit auseinander. Ein Grund ist, dass unterschiedliche, weit auslegbare Kriterien angewendet werden, um die Diagnose „Colon irritable“ zu stellen. Außerdem gehen nicht alle Menschen, die unter Beschwerden im Magen-Darm-Trakt leiden, auch zum Arzt und lassen die Ursachen abklären. Meistens macht sich ein nervöser Darm erstmals zwischen 20 und 30 Jahren bemerkbar. Frauen leiden ungefähr doppelt so oft an einem Reizkolon wie Männer.
Laut der aktuellen Leitlinie zum Reizdarmsyndrom liegt ein Reizkolon vor, wenn alle drei Bedingungen erfüllt sind:
- Die Beschwerden wie Bauchschmerzen oder Blähungen sind chronisch. Sie halten länger als drei Monate an oder kehren immer wieder. Die Symptome sind auf den Darm bezogen und gehen in der Regel mit Veränderungen des Stuhlgangs einher.
- Die Beschwerden sind der Grund dafür, dass Sie ärztliche Hilfe suchen und/oder sich Sorgen machen. Sie sind so stark, dass Ihre Lebensqualität maßgeblich beeinträchtigt ist.
- Es liegen keine anderen Krankheiten vor, die für diese Symptome verantwortlich sein könnten.
Reizdarm: Symptome
Bei einem Reizdarmsyndrom können Symptome unterschiedlicher Art und Ausprägung auftreten, die den Magen-Darm-Trakt betreffen. Bei einigen Menschen entstehen die Reizdarm-Anzeichen plötzlich und unvermittelt. Das Reizdarmsyndrom kann sich auch infolge einer Magen-Darm-Infektion entwickeln. Auch starke und andauernde seelische Belastungen könnten beim Ausbruch des Reizkolons eine Rolle spielen.
Einen Reizdarm erkennen können Ärzte, indem Sie Ihnen verschiedene Fragen zur Krankengeschichte stellen und bestimmte Untersuchungen durchführen. Sie dienen dazu, andere Erkrankungen als Ursache der Beschwerden auszuschließen. Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen wie Morbus Crohn oder Nahrungsmittelunverträglichkeiten wie die Glutenintoleranz (Zöliakie) rufen oft ähnliche Verdauungsprobleme hervor.
Typischerweise treten bei Reizdarm diese Symptome auf:
- Durchfall - ein Reizdarm ohne oder im Wechsel mit Verstopfung ist ebenso möglich
- Verstopfung
- Blähungen und ein Blähbauch
- Schmerzen und/oder Druckgefühl im Unterbauch – diese Bauchschmerzen oder Bauchkrämpfe können auch in den Rücken ausstrahlen und dann als Rückenschmerzen wahrnehmbar sein.
- Übelkeit oder Unwohlsein
- Gefühl, dass sich der Darm nur unvollständig entleert
- Häufiger Stuhlgang oder seltener Stuhlgang
- Veränderte Stuhlkonsistenz – sie kann wässrig-breiig oder hart sein.
- Manchmal befindet sich bei Reizdarm Schleim auf dem Stuhl.
Hinweis: Kein Symptom von Reizdarm ist Blut im Stuhl.
Manchmal kommen noch weitere Reizdarmsyndrom-Symptome hinzu. Diese Reizdarm-Beschwerden sind aber oft uncharakteristisch und eher allgemeinerer Natur. Sie können auch im Rahmen vieler anderer Krankheiten vorkommen. So kann zum Beispiel ein Reizdarm Müdigkeit verursachen, weil Betroffene aufgrund der Symptome schlecht schlafen. Auch kann ein Reizdarm Angststörungen oder depressive Verstimmungen hervorrufen.
Werbung
Behandlung bei Reizdarmsyndrom
Die Behandlung des Reizdarmsyndroms soll vor allem die Beschwerden lindern. Bei einem Reizdarm behandeln Ärzte also nur Ihre individuellen Symptome. Dafür haben sie verschiedene Möglichkeiten, aber auch Sie selbst können einiges tun, um die Symptome zu bessern.
Ein Reizdarm kann sehr quälend sein und den Alltag und die Lebensqualität erheblich einschränken. Viele stellen sich daher die Frage: Was tun bei Reizdarm? Diese Frage lässt sich nicht pauschal beantworten, denn es hängt von der Art der Beschwerden und der Intensität des Reizdarmsyndroms ab. Es gibt nicht „die eine“ Behandlung, die allen Betroffenen hilft und einen Reizdarm heilen kann. Meist kommt eine Kombination aus mehreren Therapien und Maßnahmen zum Einsatz.
Reizdarm: Medikamente
Bei Reizdarm kommen verschiedene Medikamente zum Einsatz, zum Beispiel gegen Verstopfung, Durchfall oder Bauchschmerzen. Der Arzt kann Ihnen bei Reizdarm Mittel verschreiben, die diese Symptome lindern. Einige Medikamente gegen Reizdarm sind rezeptfrei in der Apotheke vor Ort oder bei Internetapotheken erhältlich.
Was bei Reizdarm hilft, hängt aber von Ihren individuellen Beschwerden und ihrer Ausprägung ab. Medikamente bessern die Symptome meist nur, solange Sie diese anwenden. Wenn Sie die Mittel absetzen, kehren die Beschwerden in der Regel zurück.
Was tun bei Reizdarm? Folgende Medikamente können helfen:
- Krampflösende Mittel: Diese Medikamente entspannen die Darmmuskulatur und vermindern Unterbauchschmerzen, die mit einem Reizdarm einhergehen können.
- Mittel gegen Verstopfung (Abführmittel oder Laxantien): Diese Medikamente wirken bei Reizdarm abführend und können Verstopfungen lösen. Dazu gehören zum Beispiel Gleitmittel wie Glyzerinzäpfchen, die den Stuhl gleitfähiger machen. Auch stimulierende Mittel wie die natürlichen Wirkstoffe Rizinus oder Aloe oder der medizinische Wirkstoff Natriumpicosulfat können bei Verstopfung helfen. Sie sorgen dafür, dass mehr Wasser aus der Darmwand in den Darm strömt. Dann nehmen das Stuhlvolumen und der Füllungsdruck zu. Außerdem gibt es osmotisch wirkende Abführmittel. Dazu zählen der synthetische Hilfsstoff Macrogol und Glauber- oder Bittersalz. Über das enthaltene Salz wird mehr Wasser im Darm gebunden. Dadurch erhöht sich das Stuhlvolumen, die Darmbewegungen verstärken sich und der Darminhalt wird schneller abtransportiert.
- Antidiarrhoika: Mit diesen Medikamenten lässt sich Durchfall bei einem Reizdarm behandeln. Ein Beispiel sind Quellstoffe wie Flohsamen. Sie binden Wasser und dicken dadurch den Stuhl ein. Andere Mittel enthalten Gerbstoffe, die den Darm „beruhigen“ sollen.
- Mittel bei Blähungen: Sie sollen verhindern, dass sich übermäßig viel Gas im Verdauungstrakt bildet oder es erleichtern, die Gase auszuscheiden. Dazu gehören unter anderem Mittel mit Wirkstoffen wie Trospiumchlorid, Mebeverin oder Butylscopolamin. Sie sollen die Darmmuskulatur entspannen. Außerdem können Mittel helfen, die Verdauungsenzyme enthalten und einen eventuell vorliegenden Mangel als Ursache für die Blähungen ausgleichen. Eine weitere Therapiemöglichkeit bei Blähungen sind sogenannte „Entschäumer“. Diese sollen die winzigen Gasbläschen, die bei Blähungen entstehen, vergrößern. Dann sind sie leichter abzutransportieren. Natürliche Alternativen sind Kümmel oder Fenchel.
- Mittel gegen Übelkeit und Völlegefühl: Im Zusammenhang mit der Reizdarm-Therapie können Medikamente helfen, welche die Entleerung des Magens beschleunigen.
- Probiotika: Erhältlich sind Präparate, die bestimmte „gesundheitsfördernde“ Bakterien enthalten. Sie sollen die Zusammensetzung der Darmflora günstig beeinflussen können. So können bei Reizdarm bestimmte Probiotika die Beschwerden lindern.
- Antibiotika: Diese Medikamente sind verschreibungspflichtig. Ärzte können sie einsetzen, wenn das Darmgleichgewicht aufgrund einer akuten bakteriellen Infektion gestört ist. Antibiotika sollten jedoch laut medizinischer Leitlinie zurückhaltend zum Einsatz kommen.
- Antidepressiva: Es gibt Hinweise, dass bestimmte Antidepressiva in sehr niedriger Dosierung bei chronischen therapieresistenten (keine andere Behandlung wirkt genügend) Bauchschmerzen lindernd wirken können. Antidepressiva können auch zum Einsatz kommen, wenn Sie unter Angststörungen und Depressionen leiden.
Reizdarm: Ernährung
Die Ernährung kann ein „Schlüssel“ bei der Behandlung des Reizdarmsyndroms sein. Denn alle Lebensmittel und Getränke, die Sie zu sich nehmen, landen irgendwann im Darm. Die richtige Auswahl von Lebensmitteln kann daher einen Einfluss auf die Intensität und das Auftreten der Symptome wie Blähungen, Verstopfung oder Durchfall haben. Einem Reizdarmsyndrom vorbeugen können Sie durch eine gesunde Ernährung aber wahrscheinlich nicht.
Viele fragen sich bei Reizdarm, was sie essen sollen. Pauschal lässt sich diese Frage nicht beantworten. Eine spezielle Reizdarm-Diät, die allen Patienten gleichermaßen hilft, gibt es nicht. Die meisten Menschen mit Reizdarmsyndrom finden mit der Zeit heraus, welche Lebensmittel ihre Beschwerden eher verschlimmern – und meiden sie dann. Umgekehrt lassen sich Nahrungsmittel identifizieren, die keine oder nur geringe Verdauungsprobleme hervorrufen.
Diese Nahrungsmittel stehen im Verdacht, Symptome bei Reizdarm auszulösen oder zu verstärken:
- Milch(-produkte)
- Pilze
- Weizenerzeugnisse
- Kaffee
- Eier
- Schokolade
- Zitrusfrüchte
- Hafererzeugnisse
- Nüsse
Die sogenannte FODMAP-Diät liefert einige Empfehlungen, bei welchen Nahrungsmitteln Sie zugreifen können und bei welchen eher Vorsicht geboten ist. Das Kürzel „FODMAP“ steht für eine bestimmte Gruppe von Kohlenhydraten: Fermentierbare Oligosaccharide, Disaccharide, Monosaccharide und (engl. and) Polyole. Sie verstärken die Gasbildung und die Darmbewegung. Mediziner machen FODMAPs für verschiedene Verdauungsbeschwerden verantwortlich. Bei Reizdarm ist daher eine FODMAP-arme Diät empfohlen.
Reizdarm und Ernährung: Tabelle mit FODMAPs
Das Institut für Ernährungsmedizin der TU München hat eine Tabelle veröffentlicht, die als Anhaltspunkt für die Ernährung dienen kann:
| FODMAP | FODMAP-arm (mehr zugreifen) | FODMAP-reich (eher meiden) |
| Oligosaccharide |
|
|
| Disaccharid „Laktose“ |
|
|
| Monosaccharid „Fruktose“ |
|
|
| Polyole |
|
|
Hinweis: Die Ernährungsweise und die Lebensmittel, die ein Mensch mit Reizdarm verträgt oder nicht, sind immer individuell. Empfehlenswert ist daher, ein Ernährungstagebuch zu führen. So bekommen Sie einen besseren Überblick darüber, bei welchen Lebensmitteln die Beschwerden auftreten oder sich verstärken.
Einige allgemeine Tipps zur Ernährung bei Reizdarm:
- Generell sollten Menschen mit Reizdarmsyndrom ihren Verdauungstrakt nicht unnötig belasten. Sie sollten zum Beispiel möglichst keine fettigen Gerichte, üppige Speisen und wenig oder keinen Alkohol zu sich nehmen.
- Bei Blähungen kann es helfen, blähende und kohlenhydratreiche Lebensmittel (zum Beispiel Kohlsorten, Hülsenfrüchte wie Bohnen, Linsen) zu meiden oder den Konsum zu reduzieren. Sie sollten zudem die Mahlzeiten gründlich kauen und auf kohlensäurehaltige Getränke verzichten.
- Bei Verstopfung können viel Trinken, Joghurt und Quark sowie ballaststoffreiche Nahrungsmittel helfen.
- Bei Durchfall können zerdrückte Bananen und geriebene Äpfel den Stuhl eindicken.
Bei Reizdarm können zudem Probiotika (zum Beispiel Milchsäurebakterien) die Beschwerden oft bessern. Sie sind zum Beispiel in probiotischem Joghurt enthalten. Die Milchsäurebakterien lassen ein Darmmilieu entstehen, in dem sich „Krankmacher“ wie bestimmte Darmpilze nur schlecht vermehren können. Die Darmflora setzt sich aus Billionen verschiedenster Bakterien zusammen, die für die Darmgesundheit eine wichtige Rolle spielen. Eine starke und gesunde Darmflora ist die Voraussetzung dafür, dass sich Krankheitserreger und schädliche Mikroorganismen nicht im Übermaß vermehren können. Die Auswahl von Lebensmitteln bei einem Reizdarm kann eventuell die Zusammensetzung der Darmflora beeinflussen und somit womöglich auch die Beschwerden reduzieren.
Bei einem Reizdarm könnte das Intervallfasten zur Besserung der Symptome beitragen. Eindeutig wissenschaftlich belegt ist dies jedoch nicht. Das Intervallfasten oder intermittierende Fasten soll sich positiv auf den Stoffwechsel sowie auf das Darmmikrobiom auswirken. Es gibt verschiedene Arten des Intervallfastens, die sich im Hinblick auf die Dauer und Häufigkeit des Nahrungsverzichtes unterscheiden. Sie können zum Beispiel fünf Tage in der Woche normal essen und dann zwei Tagen fasten oder acht Stunden am Tag essen und dann 16 Stunden lang fasten.
Reizdarm: Hausmittel
Es gibt verschiedene Hausmittel, die bei Reizdarm wohltuend wirken sollen. Wissenschaftliche Beweise für die Wirksamkeit der Hausmittel gibt es aber nicht.
Einige Beispiele:
- Pfefferminzöl soll den Darm beruhigen, indem es die Darmmuskulatur entspannt.
- Das ätherische Öl des Kümmels soll gegen Völlegefühl, Blähungen, Bauchschmerzen und Übelkeit wirken.
- Kardamom soll die Verdauung unterstützen.
- Warme Kamillenkompressen sollen Bauchschmerzen oder Bauchkrämpfe lindern und die Durchblutung fördern. Viele empfinden Wärme bei Schmerzen als angenehm.
- Krampflösend bei Reizdarm soll Heilerde wirken.
- Wohltuend bei Reizdarm kann auch heißer Tee wirken, zum Beispiel Pfefferminztee.
Hypnose bei Reizdarm
Es gibt Hinweise darauf, dass psychische Faktoren die Verdauungsfunktion beeinflussen – und damit auch eine Rolle dabei spielen, ob und wie stark die Reizdarm-Symptome ausgeprägt sind.
Bei intensiven Beschwerden kann eventuell eine kognitive Verhaltenstherapie oder eine Hypnose (Darmhypnose oder Bauchhypnose) hilfreich sein. Bei einer Darmhypnose erreichen Sie einen tiefen Entspannungszustand und richten Ihre Aufmerksamkeit auf Ihren Darm. Gearbeitet wird mit dem Prinzip der Imagination, also mit positiven Bildern. Sie können sich Ihren Darm zum Beispiel als einen ruhig fließenden Fluss vorstellen. Die Hypnose soll die Kommunikation zwischen dem Darm und Gehirn verbessern und die Beschwerden lindern.
Auch Entspannungstechniken könnten dazu beitragen, dass Sie sich besser fühlen, wenn Ihre Beschwerden auf Stress und psychische Belastungen zurückzuführen sind. Yoga, Meditation oder Progressive Muskelentspannung könnten sich bei einem Reizdarmsyndrom eventuell positiv auswirken. Hinreichend erforscht ist ihre Wirkung aber noch nicht.
Reizdarm-Selbsthilfegruppen finden Sie unter anderem unter https://reizdarmselbsthilfe.org/ oder https://reizdarmselbsthilfe.de/.
Was tun bei Reizdarm oder entzündlichen Darmerkrankungen? (Podcast #12)
Gast: Prof. Jost Langhorst, Facharzt für Innere Medizin und Gastroenterologie am Evang. Krankenhaus Essen-Steele (Evang. Kliniken Essen-Mitte)

© privat
Mehr Infos zur Folge
Ein leichtes Vollgefühl, Blähungen, Bauchgrummeln oder mal Durchfall – das kennt jeder. Wenn Verdauungsprobleme gehäuft auftreten und chronisch werden, können jedoch ernsthafte Erkrankungen dahinterstecken.
In dieser Folge sprechen wir mit dem Gastroenterologen und Internisten Prof. Jost Langhorst darüber, wie sich Reizdarm oder entzündliche Darmerkrankungen äußern und was man dagegen tun kann.
Wir fragen nach, welche Rolle die Ernährung dabei spielt und wie man mit Arzneipflanzen die Beschwerden lindern kann. Und wir wollen wissen, was bei diesen Krankheiten genau im Darm passiert.
Reizdarm: Ursachen
Die Ursachen des Reizdarms sind noch nicht genau geklärt, aber es gibt verschiedene Theorien zur Entstehungsweise. Vermutlich gibt es nicht „die eine“ Ursache für das Reizdarmsyndrom, sondern es müssen mehrere Faktoren (biologische, psychische und soziale) zusammenspielen, damit die Erkrankung entsteht.
Fachleute sehen das Reizdarmsyndrom als „Störung der Darm-Hirn-Achse“ an. Über Nerven und Botenstoffe kommunizieren diese beiden Organe und arbeiten eng miteinander zusammen. Die Leitlinie schreibt: „Das Reizdarmsyndrom kann mit organischen, zellulären, molekularen und/oder genetischen Veränderungen auf allen Ebenen und in allen Komponenten der Darm-Hirn-Achse assoziiert sein.“
Forschende diskutieren unter anderem folgende Ursachen und Risikofaktoren für den Reizdarm:
- Die natürlichen Darmbewegungen sind gestört – der Prozess der Anspannung und Entspannung der Darmmuskulatur, durch den die verdaute Nahrung weitertransportiert wird, läuft zu schnell oder zu langsam ab.
- Die Darmnerven sind überempfindlich und die Schmerzschwelle im Darm ist besonders niedrig.
- Die Zusammensetzung der Darmflora ist verändert.
- Gestörter Gallensäurestoffwechsel – zu viele Gallensäuren können im Dickdarm vorhanden sein. Auch die Gallensäureproduktion in der Leber kann erhöht sein.
- Entzündungen der Darmwand - manchmal kann dem Reizdarm eine Entzündung im Darm vorausgegangen sein.
- Frühere Darminfektion (Viren, Bakterien) mit Fieber und starkem Durchfall – die Symptome des Reizdarmsyndroms können sich auch noch Monate oder sogar Jahre nach überstandener Infektion entwickeln. Je schwerer die Infektion war, desto höher ist das Risiko für Reizdarm-Symptome.
- Vorherige Behandlung mit Antibiotika – diese Medikamente richten sich gegen krankmachende Bakterien. Allerdings greifen Antibiotika auch „gesundheitsfördernde“ und nützliche Bakterien der Darmflora an. So kann das Gleichgewicht aus der Balance geraten.
- Hormonelle Einflüsse: Neuere Studien legen nahe, dass Sexualhormone an der Entstehung des Reizdarms beteiligt sein könnten. Der Grund für diese Annahme ist die Häufung des Reizdarmsyndroms bei Frauen im gebärfähigen Alter. Höhere Östrogenspiegel sind mit einer verminderten Darmbeweglichkeit verbunden.
- Erbliche Veranlagung – die Gene könnten mitspielen
- Stress und seelische Belastungen scheinen beim Reizdarm eine Rolle zu spielen. Belastungen im Alltag oder einschneidende Ereignisse (zum Beispiel Scheidung, Jobverlust, Todesfall) können die Wahrscheinlichkeit erhöhen, an einem Reizdarm zu erkranken. Stress kann also ein Risikofaktor sein.
- Ernährungsgewohnheiten, Lebensmittelunverträglichkeiten
Dass ein Reizdarm durch die Pille entsteht, ist nicht belegt. Die Pille enthält jedoch Hormone, die wiederum das Darm-Mikrobiom beeinflussen können. Manche Frauen erleben Verdauungsprobleme wie Blähungen, Durchfall und Verstopfung, wenn sie die Pille einnehmen, besonders ins der Anfangsphase. Diese Symptome sind ähnlich wie bei einem Reizdarmsyndrom. Frauen, die die Pille einnehmen und mit häufigen Magen-Darm-Problemen zu kämpfen haben, sollten Rücksprache mit ihrem Gynäkologen halten.
Werbung
Reizdarm: Diagnose
Reizdarm verursacht Symptome, die auch bei einigen anderen Erkrankungen vorkommen können und unspezifisch sind. Bis jetzt gibt es keine spezielle Untersuchung, durch die sich ein Reizdarm eindeutig feststellen lässt. Daher gilt es, andere Erkrankungen als Grund für die Beschwerden auszuschließen. So können chronisch-entzündliche Darmerkrankungen wie Morbus Crohn oder eine Glutenunverträglichkeit (Zöliakie) ähnliche Symptome auslösen.
Um die Diagnose „Reizdarm“ zu stellen oder auszuschließen sammeln Ärzte zunächst einige Informationen zu Ihrer Krankengeschichte (Anamnese).
Mögliche Fragen sind:
- Welche Symptome haben Sie genau?
- Wann sind die Beschwerden erstmals aufgetreten?
- Wie intensiv sind die Symptome ausgeprägt?
- Gibt es Situationen, in denen sich die Beschwerden bessern oder verstärken?
- Sind Krankheiten bei Ihnen bekannt – welche?
- Nehmen Sie Medikamente ein – welche und seit wann?
- Gibt es das Reizdarmsyndrom in Ihrer Familie?
- Haben oder hatten Sie viel Stress?
- Wie sieht Ihre Ernährung aus?
Anschließend folgt in der Regel eine körperliche Untersuchung. Dabei tastet der Arzt mit den Händen unter anderem den Bauch ab, um Auffälligkeiten zu erspüren.
Durch eine Stuhluntersuchung im Labor lassen sich zum Beispiel krankmachende Bakterien oder Darmparasiten nachweisen, welche die Ursache für die Reizdarmbeschwerden sein könnten. Eine Ultraschalluntersuchung (Sonografie) des Bauchraums kann Erkrankungen von Organen im Bauchraum wie der Bauchspeicheldrüse, Leber oder Gallenblase sichtbar machen.
Bei Reizdarm kann eine Darmspiegelung weiterhelfen. Sie zeigt, ob es Veränderungen und Auffälligkeiten im Darm gibt. Die Darmspiegelung kann zudem Hinweise auf Darmkrebs liefern. Auch Laboruntersuchungen (zum Beispiel Blutbild, Entzündungswerte) können aufschlussreich sein.
Eventuelle Nahrungsmittelunverträglichkeiten lassen sich zum Beispiel mittels Atemtest oder Laktose-Belastungstest nachweisen beziehungsweise ausschließen.
Welcher Arzt bei Reizdarm?
Der erste Ansprechpartner bei Verdauungsproblemen ist meist der Hausarzt. Er kann Sie beim Verdacht auf Reizdarm an einen Spezialisten überweisen. Zuständig ist hier ein Gastroenterologe. Dies ist ein Arzt, der sich auf die Organe des Verdauungstrakts spezialisiert hat. Sein Fachgebiet heißt entsprechend Gastroenterologie. Einen Reizdarm behandelt ein Gastroenterologe entweder in seiner Praxis oder in einer Klinik mit Reizdarm-Fachabteilung. Es gibt auch spezielle Reha-Kuren bei Reizdarm. Ein Verzeichnis finden Sie zum Beispiel unter https://reizdarmselbsthilfe.de/
Auch Kinder und Jugendlichen können unter einem Reizdarmsyndrom leiden. In manchen Familien treten die Beschwerden gehäuft auf. Wenn Sie vermuten, dass ihr Kind am Reizdarmsyndrom leidet, sollten Sie einen Kinder- und Jugendarzt besuchen. Er kann abklären, ob ein Reizdarm oder eine andere Krankheit hinter den Symptomen steckt.
Werbung
Reizdarm: Dauer und Verlauf
Die Dauer und der Verlauf eines Reizdarms können individuell verschieden sein. Daher lassen sich keine allgemeinen Aussagen dazu treffen, wie lange der Reizdarm besteht. Aber meist besitzt das Reizdarmsyndrom einen chronischen Verlauf und eine längere Dauer. In diesem Fall haben Menschen langfristig mit Beschwerden zu tun. Oft verläuft die Erkrankung in Schüben. Dann gibt es Zeiten mit geringen oder keinen Darmproblemen und Phasen mit stärkeren Symptomen.
Bei den meisten Patienten lassen sich die Symptome mittels medikamentöser und nicht-medikamentöser Behandlungsmaßnahmen gut in den Griff bekommen. Ein Verfahren, das (sofortige) Heilung verspricht, gibt es aber nicht.
Reizdarm: Folgen
Wichtig ist, dass das Reizdarmsyndrom nicht zu Organschäden führt und Menschen mit Reizdarm eine normale Lebenserwartung haben. Nur selten bildet sich das Reizdarmsyndrom mit der Zeit von selbst zurück. Bei den meisten bleibt der Reizkolon dauerhaft bestehen.
Welche Folgen ein Reizdarm hat und wie sich die Erkrankung auf das alltägliche Leben und allgemeine Befinden auswirkt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Eine Rolle spielt es, wie stark Ihre Symptome ausgeprägt sind, wie sehr Sie sich beeinträchtigt fühlen und wie stark Sie die Beschwerden psychisch belasten. Treten nur gelegentlich Symptome auf, können viele recht gut mit dem Reizdarmsyndrom leben. Sind die Beschwerden jedoch heftig und treten ständig oder sehr oft auf, kann die Lebensqualität merklich beeinträchtigt sein.
Eine Folge des Reizdarms kann ein Gewichtsverlust sein. Wenn Sie zahlreiche Lebensmittel meiden, können Sie an Gewicht verlieren. Außerdem möchten viele Menschen mit Reizdarm nicht mehr im Restaurant oder bei Freunden essen. Die soziale Isolation kann eine Folge von Reizdarm sein. Bei manchen schlagen sich die Beschwerden aufs Gemüt. Betroffene sind oft niedergeschlagen – dies kann bis hin zur Depression reichen.
Quellen
- S3-Leitlinie Reizdarmsyndrom (Deutsche Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten (DGVS) und Deutsche Gesellschaft für Neurogastroenterologie und Motilität (DGNM), Stand: Juni 2021
- Online-Informationen Bundesärztekammer: www.bundesaerztekammer.de; Abruf: 09.01.2025
- Online-Informationen Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWIG): www.gesundheitsinformation.de; Abruf: 09.01.2025
- Online-Informationen Berufsverband Deutscher Internisten e.V.: www.internisten-im-netz.de; Abruf: 10.01.2025
- Online-Informationen Institut für Ernährungsmedizin, Klinikum rechts der Isar, TU München: www.mri.tum.de; Abruf: 10.01.2025
- Online-Informationen Deutsche Reizdarm Selbsthilfe e.V.: reizdarmselbsthilfe.de; Abruf: 10.01.2025
- Online-Informationen Gastro Liga e.V.: www.gastro-liga.de; Abruf: 10.01.2025
- Online-Informationen Das Gastroenterologie-Portal: dasgastroenterologieportal.de0; Abruf: 10.01.2025
- Online-Informationen National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases: www.niddk.nih.gov; Abruf: 10.01.2025
- Online-Informationen National Health Service (NHS): www.nhs.uk; Abruf: 10.01.2025
- Pressemeldung Gastro Liga e.V.: Gesundheitstelefon mit Experten: Bauchschmerzen – harmlos oder ein Warnzeichen für eine ernste Erkrankung?; 18.09.2024