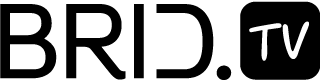© PhotoCuisine
Äpfel, Banane, Mango – wenn Moritz Wagner Lust auf Süßes hat, schnippelt er sich eine Schüssel Obst. „Das hat schon meine Mutter gemacht, wenn mein Bruder und ich als Kinder vor dem Fernseher saßen“, grinst der 2,11-Meter-Hüne und Basketball-Profi. Seit 2018 spielt der geborene Berliner in der US-amerikanischen Basketball-Liga NBA. Gemüse zu mögen lernte er von klein auf. In der von seiner Mutter befüllten Brotbox gab es außer Vollkornstullen Gurke, Paprika oder Fenchelknollen. Abends Rohkost und Salat. „In meiner Familie war das völlig normal, ich kannte das nur so“, sagt Wagner. Dass es auch anders geht, und zwar schlechter, wurde ihm erst bewusst, als er mit seinem Verein Alba Berlin zu Jugend-Spielen reiste. Seine Mitspieler verschmähten Grünzeug und Gemüse.
Warum wir essen, was wir essen
Wir essen und mögen, was Mama oder Papa zu Hause auf den Tisch gestellt hat. Ob Rindsrouladen oder Rote Bete, die Geschmäcker aus Kindheit und Jugend verleihen jedem das Gefühl von Heimat. Manche verzichten auf Speisen, weil sie Tieren kein Leid zufügen möchten. Andere ekeln sich vor Insektenragout oder Austern, weil sie vermeintlich unsauber sind oder so aussehen. Und fast jeder fliegt auf Süßes und Fettiges und stößt Bitteres mit einem Ausdruck des Widerwillens weg. Aber warum essen wir eigentlich, was wir essen? Und warum ist es so schwer, sein Essverhalten zu ändern?
Die Antwort ist auch im Zeitalter der Supercomputer nicht einfach. Am leichtesten fällt sie für den großen Rahmen, den die Biologie vorgibt: Süßes und Fettiges liefern Energie zum Überleben und sind daher gut. So entspannen sich die Gesichter Neugeborener, wenn sie süße Flüssigkeit in den Mund getröpfelt bekommen. Beim Wechsel auf Bitteres gehen ihre Mundwinkel nach unten, sie kneifen die Augen zusammen, strecken die Zunge heraus und wenden den Kopf ab. Kinder kommen mit einer Vorliebe für Süßes und einer Ablehnung von Bitterem auf die Welt. „Süßes signalisierte unseren Vorfahren energiereiche Nahrung in Form von Kohlenhydraten“, sagt Heinz Breer, Physiologe von der Uni Hohenheim.
Werbung
Warum bestimmte Lebensmittel in manchen Ländern beliebter sind als in anderen
Süß ist ungefährlich, wussten unsere Vorfahren. „Es gibt eigentlich keinen süßen Naturstoff, von dem Gefahr ausgeht“, sagt Breer. Bitterstoffe hingegen signalisieren häufig Schädliches, ihre Ablehnung schützte unsere Ahnen vor giftigen Pflanzen, Beeren und Pilzen. Frauen, so zeigen Messungen, reagieren besonders empfindlich auf Bitteres. Vermutlich handelt es sich dabei um eine Art evolutionäre Extrasicherung: Sie mussten selbst in fleischlosen Zeiten für Essbares sorgen, das ihre Kinder vertrugen und auch für sie ungefährlich war. Aus gleichem Grund vermuten Wissenschaftler, sind Frauen experimentierfreudiger, wenn es um das Ausprobieren neuer Speisen geht: Kamen die Jäger ohne Beute heim, mussten sie aus dem, was sie gesammelt hatten, etwas Bekömmliches zaubern – und das war, wie Studien belegen, eher die Regel als die Ausnahme.
Die Bedürfnisse und Vorlieben, aber auch die Fähigkeit, sich Rohstoffe zu erschließen und einen Vorteil zu gewinnen, haben sich tief im genetischen Code verankert. 98 Prozent der Asiaten vertragen keine Kuhmilch, weil ihnen das Enzym Laktase fehlt, das den Milchzucker Laktose abbaut. Die Rinderzucht zur Gewinnung von Nahrung spielte bei ihnen auch nie eine so große Rolle wie in Europa. Schweden und Briten dagegen reagieren besonders empfindlich auf das Klebereiweiß Gluten im Getreide.
Über die Gründe dafür rätseln die Forscher noch – wie auch über die Unterschiede bei der Wahrnehmung von Bitterem: Während Italiener genüsslich täglich tassenweise bitteren Espresso in sich hineinschütten, reagieren Afrikaner höchst sensibel auf Bitteres. Evolutionäre Gründe hat wohl auch die Vorliebe für scharf gewürzte Speisen in vielen heißen, vorwiegend asiatischen Ländern: Scharfstoffe regen die Schweißproduktion an und kühlen so den Körper ab. Zudem überdecken sie den Geschmack verdorbener Lebensmittel, die es dort aufgrund der hohen Temperaturen häufiger gibt, und hemmen das Wachstum von Bakterien.

© FOCUS-GESUNDHEIT
Die Europäer können Milch sehr gut verwerten, rund 85 Prozent der Deutschen und 98 Prozent der Schweden. Sie besitzen ein Enzym, um Laktose (Milchzucker) aufzuspalten. In Afrika und Südasien ist diese Fähigkeit weniger verbreitet. Nach Milchgenuss leiden die Menschen unter Blähungen oder Durchfall
Der Einfluss der Eltern auf unser Essverhalten
Die Evolution liefert aber nur den groben Rahmen dafür, was Menschen als vertilgbar erachten. Sie hat daneben offenbar viel Raum gelassen, damit der Nachwuchs sich an die lokalen Gegebenheiten anpassen kann – und zwar bereits im Mutterleib: Aromastoffe aus der mütterlichen Nahrung gelangen ins Fruchtwasser. Dieses ähnelt einer Art Suppe, deren Geschmack sich im Verlauf des Tages ändert, je nachdem, was die Mutter gegessen hat. Experimente bestätigen das. Kinder, die in der Schwangerschaft via Fruchtwasser Karottensaft-Aromen bekamen, mochten später eher Karottenbrei. Neugeborene, deren Mütter Anis konsumiert hatten, reagierten – erkennbar durch Grimassen – freundlicher auf das Gewürz als ihre anisunerfahrenen kleinen Studiengenossen.
Selbst in der Muttermilch schwimmen Geschmacksstoffe der mütterlichen Speisen und übertragen sich auf das Kind. Um das zu beweisen, baten Forscher des Europäischen Zentrums für Geschmackswissenschaften und Ernährungsverhalten, kurz CSGA, in Dijon 300 Mütter,
ein Ernährungstagebuch zu führen. Kinder, die während der Schwangerschaft und Stillzeit über die Ernährung der Mutter mit heftigen Aromen wie Fisch, gereiftem Käse, Pfeffer oder Knoblauch konfrontiert waren, reagierten im zarten Lebensalter von acht Monaten entspannter auf diese Gerüche.
Vermutlich entstehen so kulturelle Prägungen: Chinesen lieben 100-jährige Eier oder Asiaten die Stinkfrucht, sie hassen dagegen reifen Käse. Dafür essen Kinder in Peru so scharf, dass selbst Erwachsene hierzulande zu schwitzen beginnen. In China verspeisen die Menschen Schlangen, Ratten oder Hunde, die wir nie anrühren würden. Und keine Nation steht so auf Butter wie die Deutschen. Was die einen lieben, lässt andere angeekelt das Gesicht verziehen: Lakritze, Rosinen, Austern oder Koriander – Appetit und Abscheu liegen oft haarscharf nebeneinander.
Der Einfluss der Eltern setzt sich fort, wenn die Kleinen anfangen, eigenständig zu essen. "Kinder sind von Natur aus neugierig. Deshalb: immer mal was Neues anbieten und klarmachen, dass sie es nicht aufessen müssen, sondern dass probieren genügt", sagt Ernährungsmedizinerin Ute Gola aus Berlin. Dabei sollten Eltern ihre Vorbildfunktion nicht unterschätzen: "Wenn der Vater kein Gemüse isst, kann die Mutter noch so viel davon zubereiten, die Kinder werden es vermutlich nicht kosten."
"Je mehr Abwechslung Eltern auf den Tisch packen, umso eher sind Kinder offen für Neues."
Ute Gola, Ernährungsmedizinerin aus Berlin
Werbung
Wie Hormone unser Essverhalten beeinflussen
Der Appetit, also das, worauf man im Augenblick gerade Verlangen spürt, ist stark vom individuellen Ernährungszustand beeinflusst. „Hormone informieren unser Gehirn darüber, über wie viele Energiereserven wir verfügen“, sagt Physiologe Heinz Breer von der Universität Hohenheim.
Gesteuert wird der Prozess von einem etwa erbsengroßen Gebilde im Gehirn, dem Hypothalamus. Er beherbergt ein komplexes Netzwerk aus Nervenzellen, das von Hormonen wie Leptin und dessen Gegenspieler Ghrelin gesteuert wird. Die Quelle dafür: das Fettgewebe. Je mehr Fett da ist, umso höher ist beispielsweise der Leptin-Spiegel im Blut. Das Hormon blockiert die Nervenzellen, die unseren Appetit anfeuern, und aktiviert jene, die Esslust zügeln. Dadurch essen wir automatisch weniger. Sind wir ausgezehrt von einer mehrwöchigen Wanderung, durch Krankheit oder schlicht, weil wir eine Zeit lang zu wenig gegessen haben, sinkt der Leptin-Spiegel, was die Lust zu essen befeuert.
Das Wechselspiel aus Hunger und Sattsein ist angeboren. In einem idealen Dasein essen wir, wenn wir Hunger haben. Sind wir satt, interessiert uns Nahrung nicht. Doch diesen natürlichen Rhythmus beobachtet man heutzutage allenfalls bei Säuglingen und Kleinkindern. „Wer sich im Restaurant umschaut, wird auf Kindertellern viel häufiger Reste finden als auf Tellern von Erwachsenen. Weil Kinder meistens aufhören zu essen, wenn sie satt sind. Manchmal schon nach einer kleinen Portion“, sagt Mareike Awe, Ärztin und Erfinderin von „intueat“, einem Programm, das ohne Diäten zum Wohlfühlgewicht führen soll.
Je älter Menschen werden, umso geringer ist der Anteil derer, die beim Essen noch auf ihre Intuition hören. „Durch Überfluss und Regeln haben wir verlernt, echte Hungersignale zu erkennen“, sagt Awe. Stattdessen regeln Gewohnheiten, Appetit und Geschmack nicht nur was, sondern auch wie viel wir essen.
Wie unsere Umgebung beeinflusst, was und wieviel wir essen
Auch die Umgebung spielt eine maßgebliche Rolle. Ein Raum, ein Tisch, sechs Stühle und jede Menge Suppenteller – für ihren Versuch servierten die Forscher der Universität Hohenheim 225 Studenten Tomatensuppe. Die Ernährungs-Profis wollten wissen, wie sehr der Geschmack einer Speise von äußeren Einwirkungen beeinflusst wird. Als die eine Gruppe sich zum Essen setzte, war das Licht gedimmt, wie in einem gemütlichen Restaurant. Bei einer zweiten Gruppe verbreitete grelle Beleuchtung Kantinenatmosphäre. Mal wurde das Essen auf einem Tischtuch serviert, mal ohne. Am meisten und längsten griffen die Teilnehmer an dem Tisch mit Tafelleinen und Kuschelatmosphäre zu. Ihnen schmeckte auch die Suppe – obwohl alle die gleiche löffelten – am besten.
Seit 20 Jahren erforscht Ernährungspsychologin Nanette Ströbele-Benschop von der Universi-tät Hohenheim – sie gestaltete das obige Experiment – sogenannte Nudges. Das sind Verhaltensstupser, die uns hin zu einer besseren und gesünderen Ernährung lenken können. Aus den Erkenntnissen lassen sich viele kleine Alltagstricks ableiten: Wer kleinere Löffel oder Teller benutzt, isst automatisch weniger. Aus der Lieblingstasse schmeckt nicht nur der Kaffee besser, sondern auch Leitungswasser. Der Konsum von Süßigkeiten sinkt rapide, wenn wir die Leckereien nicht ständig im Blick haben, sondern sie im Küchenschrank oder in der Schublade
lagern.
Mit ihrem Doktorvater John de Castro von der US-Uni Georgia State University in Atlanta untersuchte die Ernährungspsychologin zudem, ob sich gemeinsame Mahlzeiten auf die verzehrte Menge und den Appetit auswirken. Ergebnis: „Zusammen mit Freunden oder Familie verspeisen wir mehr“, sagt Ströbele-Benschop. Weil wir länger sitzen, entspannt sind und es einfach in gemütlicher Runde besser schmeckt. Der Effekt hängt direkt mit der Gruppengröße zusammen und lässt sich messen. „Bei sieben oder mehr Menschen am Tisch essen wir bis zu 76 Prozent mehr, als wenn wir allein oder zu zweit am Tisch sitzen“, sagt die Forscherin.
Essen ist also immer auch mit Gefühlen verbunden, die einer Speise oder einem Getränk anhaften, ohne dass uns das bewusst wäre. In der Taverne in Griechenland mag der Rotwein extrem lecker gewesen sein. Zu Hause auf der Terrasse mundet das gleiche Getränk aber fade oder sauer. Warum? Im Urlaub schmecken wir den Blick aufs Meer mit, und in der Wohnung bestimmen die eigenen vier Wände unsere Wahrnehmung.
Werbung
Nahrung als Beruhigungsmittel
Ein gutes Mahl hilft auch, Stress und schlechte Gefühle zu bewältigen. Experten sprechen vom emotionalen Essen. „Nahrung ist ein hochpotentes Beruhigungsmittel, das in unserer Überflussgesellschaft jederzeit zugänglich ist und zunächst einmal keine Nebenwirkungen hat“, sagt Michael Macht, Psychologe von der Universität Würzburg.
"Viele Menschen nutzen Nahrungsmittel, um Emotionen besser zu ertragen, um sich zu entspannen." Wir fressen buchstäblich den Frust in uns rein, wenn wir nachts den Kühlschrank leeren, weil uns unsere Sorgen nicht schlafen lassen – vornehmlich Fettiges und Süßes, wie es biologisch vorgegeben ist. Ihre Wirkung entfaltet Nahrung auf vielen Wegen: weil Wohlgeschmack einfach ein gutes Gefühl hinterlässt. Weil Nährstoffe den Cortisolspiegel dämpfen, der bei Stress erhöht ist. Und weil süße oder fettige Häppchen Glückshormone freisetzen.
Basketballer Moritz Wagner war froh, dass er in der gesunden Ernährung so fest verankert war, als er 2017 in die USA zog. Damals sollte er Muskelmasse aufbauen. Plötzlich standen täglich Pancakes und Rührei auf dem Speiseplan. Und weil es in den USA an jeder Ecke Fast Food gibt, griff Wagner viel öfter nach frittierten Hähnchenschenkeln oder Hamburgern als nach Salat und Vollkornbrot. Nach zwei Jahren merkte er, dass ihm diese Mästerei zu einseitig war.
Er wechselte wieder zu seiner persönlichen Wohlfühlernährung mit viel Gemüse, Fisch und hellem Fleisch. "Ich fühlte mich sofort wieder besser. Der hohe Anteil von Zucker und Fett dämpft nicht nur meine Leistung auf dem Platz, sie wirkt sich auch auf Gemüt und Schlaf aus – das habe ich deutlich gespürt."
Die mögliche Hinwendung zur ungesunden Ernährung beginnt schon beim Einkauf. Was im Korb landet, ist selten geplant, zumindest nicht von uns Verbrauchern. Musik, Temperatur, Lichtdesign und Düfte, die Anordnung der Lebensmittel und Sonderangebote steuern, was im Korb landet. Wir kaufen, was lecker aussieht und gut riecht. Und das, was andere wollen. „Wenn einige Menschen ein Lebensmittel im Supermarkt anschauen, wird es für uns attraktiver. Der Blick des Gegenübers vermittelt uns, dass dieses Produkt potenziell wichtig und relevant für uns sein könnte“, sagt Soyoung Park, Leiterin der Abteilung Neurowissenschaft der Entscheidung und Ernährung am Deutschen Institut für Ernährungsforschung in Potsdam-Rehbrücke (DIfE).
96 Prozent der Frauen ist es wichtig, dass ihr Essen gesund ist; das gilt nur für 88 Prozent der Männer.
(Quelle: BMEL-Ernährungs-report 2018)
Uns schmeckt, was uns Wohlgefühl vermittelt. Am Ende schleppen wir außer Milch, Brot und Eiern noch allerlei nach Hause, was wir gar nicht brauchen: Croissants aus dem Backshop, vegetarische Wurst vom Aktionstisch, ein Glas Nutella, das es nur heute im Angebot gibt. „Der Einkauf soll bequem, die Atmosphäre im Supermarkt angenehm sein und zu unserer Stimmung passen“, sagt Einzelhandelsexpertin Beate Scheubrein von der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Heilbronn.
„Die Läden erschaffen ein positives Einkaufserlebnis, damit wir uns länger dort aufhalten. Jede Minute länger bedeutet, dass wir auch mehr einkaufen.“ Die meisten Supermärkte sind daher nach dem gleichen Prinzip aufgebaut: Entgegen dem Uhrzeigersinn schieben wir mit der linken Hand den Wagen durch breite Gänge und packen mit rechts den Korb voll. Die meisten sind Rechtshänder. Tomaten, Salat und Paprika erscheinen im Kunstlicht wie besonders knackige Vitaminbomben. Am Gewürzregal erinnert der Geruch an Curry, das wir schon immer kochen wollten, Brotduft leitet uns zum Backregal.
Man ist, was man isst
Moritz Wagner ist gegen derlei Versuchungen resistent. Als Basketball-Profi hat er Disziplin gelernt. „Mein sportlicher Erfolg liegt in meiner Hand, er hängt von der Gesundheit und einem guten Körpergefühl ab“, sagt der NBA-Spieler selbstbewusst. Eine gute Ernährung, glaubt Wagner, spielt dabei eine Schlüsselrolle. Der Leistungssportler überlegt nun sogar, einen Koch zu engagieren, der Speisen für ihn so zubereitet, dass sein Körper optimal arbeitet. Auf die Idee kam er, als seine Mutter Beate, übrigens Autorin von FOCUS-Gesundheit, ihn besuchte und so gesund kochte wie einst zu Hause. „Ich fühlte mich super. Derart ausgewogen kann man außer Haus kaum essen“, sagt Wagner. Man ist, was man isst, das kann er förmlich spüren.
Dies ist eine gekürzte Fassung. Den vollständigen Text finden Sie in FOCUS-GESUNDHEIT „Gesunde Ernährung" – als Print-Heft oder als digitale Ausgabe.